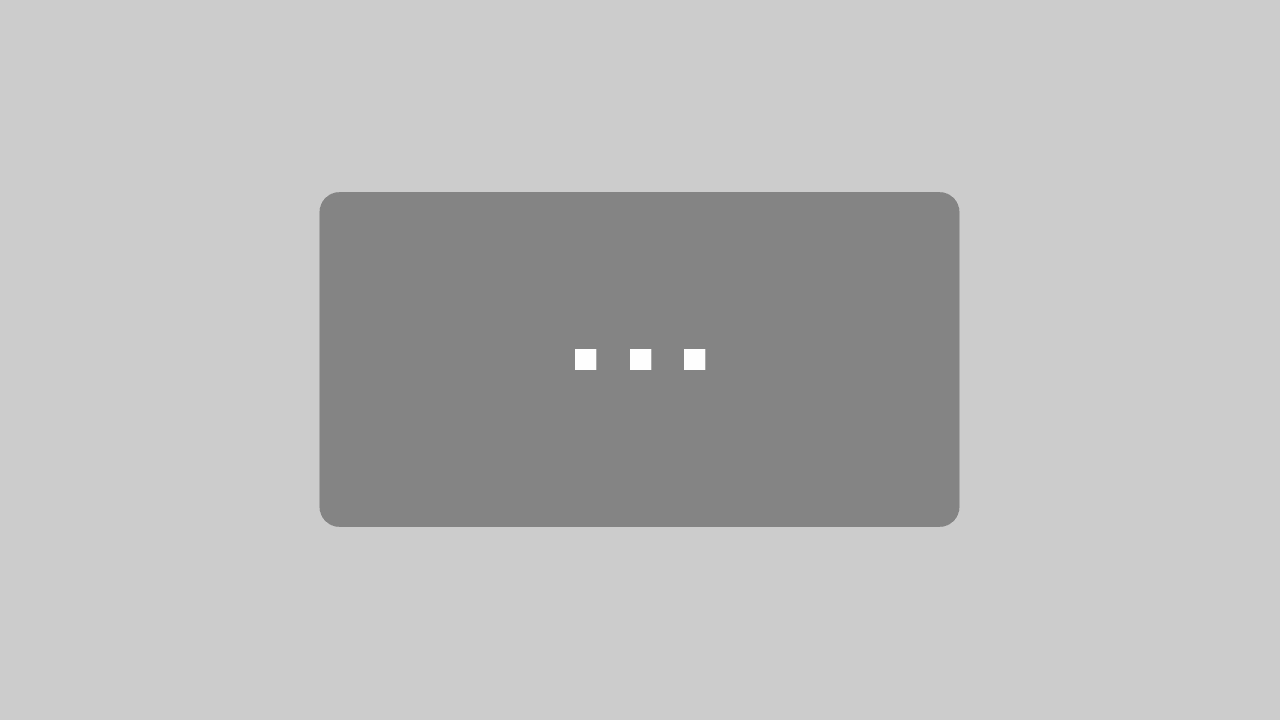von P. Julian M. Schaumlöffel OSB
Das eigentliche und auch erste Meisterwerk von Egid Quirin Asam ist der 1722–1723 erstellte szenische Hochaltar, der den Kirchenraum der Benediktinerabtei Rohr in Niederbayern dominiert, «eine mit allen rhetorischen, perspektivisch-illusionistischen und theatralischen Kunstgriffen visualisierte plastische Darstellung der Himmelfahrt Mariens».
Die Ausmaße dieser raumbeherrschenden Altarinstallation sind eindrücklich und haben mich beim Betrachten überwältigt.
Der offene Sarkophag steht weit über dem Chorboden. Die beiden Altarbauten sind sieben Meter tief und deren Säulen fast 8 Meter hoch, bilden aber für den Betrachter eine einzige Schauwand. Für dieses eindrückliche «Theatrum sacrum» setzten die Asam ihre Kenntnisse aus dem Studium der Lichtinszenierungen Berninis genial um.
Eine mächtige goldene Krone von 5 Metern Durchmesser schließt die Giebelstücke des Alters zusammen. Auf der Monumentalbühne erscheint als lebendes Bild die Himmelfahrt Mariens. Über drei Stufen steht der Sarkophag. Von allen Seiten eilen die Apostel in erregter Bewegung herbei. Sie finden das Grab leer, der Deckel lehnt an der Rückwand. Maria aber schwebt, von Engeln getragen in die übergroße Krone hinein und zum Himmel empor, wo sie von der Hl. Dreifaltigkeit und Engelschören erwartet wird. Ein gelbes Fenster an der Rückwand wirft goldenes Licht auf die himmlische Szenerie.
Liebe Schwestern und Brüder!
Wir feiern heute das Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel. Am 1. November 1950 hat Papst Pius XII. feierlich das Dogma verkündet, die Gottesmutter Maria sei nach Vollendung ihres irdischen Lebens mit Leib und Seele in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen worden. Das heutige Fest hat seinen wahren Ursprung jedoch nicht in diesem Dogma; der Glaubenssatz hält auf feierliche Weise fest, was seit dem 4. Jahrhundert aus der Volksfrömmigkeit (vor allem der Ostkirche) in das Glaubensbewusstsein der Kirche gelangt ist und dort seit anderthalb Jahrtausenden seinen festen Platz hat.
Und genau dieses Glaubensbewusstsein hat die Künstler aller Epochen inspiriert, die Himmelfahrt Mariens darzustellen. Ein Beispiel dafür ist das eingangs beschriebene Kunstwerk der Asam in Rohr.
Genau 300 Jahre später wurde hier im Sauerland für die Gemeinde St. Clemens in Drolshagen ein Flügelaltar in Auftrag gegeben. Schon die Tatsache, dass eine Gemeinde im 21. Jahrhundert einen Hochaltar in Auftrag gibt ist ungewöhnlich, noch ungewöhnlicher aber ist die dortige Darstellung der Himmelfahrt Mariens.
Das Altarbild des Künstlers Thomas Jessen aus Eslohe zeigt im Zentrum die Gottesmutter Maria auf einer Klappleiter stehend. Die fotorealistisch gemalten, lebensgroßen Figuren wirken dabei auf den ersten Blick eher wie Gemeindemitglieder oder Handwerker, die dabei sind, den im Hintergrund erkennbaren Altarraum neu zu gestalten. Das am Pfingstmontag dieses Jahres zur Altarweihe enthüllte Bild soll die Himmelfahrt Mariens in einer modernen Version zeigen. Die Mutter Jesu trägt dabei Jeans und Rollkragenpullover und steht auf einer Trittleiter unter dem Kreuz. Neben Maria stehen die heilige Veronika als Handwerkerin, ebenfalls in moderner Alltagskleidung und ohne Heiligenschein, sowie der ungläubige Thomas in Jeans und mit freiem Oberkörper – ein Selbstbildnis des Künstlers. Im Sauerland und gerade in Drolshagen erregt dieser Altar nun seit Wochen die Gemüter. Darf man die Gottesmutter und die anderen Heiligen so darstellen?
Während Maria im barocken Rohr von Engeln getragen in die Glorie des Himmels entschwebt, muss die Gottesmutter in Drolshagen in Arbeitskleidung selbst die Holzleiter erklimmen, um in den Bereich ihres am Kreuz dargestellten Sohnes zu gelangen. Die Leiter ist hier das verbindende Moment, denn während der Körper Mariens noch vor dem Rot irdischen Liebens und Leidens dargestellt ist, reicht ihr Kopf schon in die Kreuzigungsszene des Himmels hinein, in der das kräftige Blau dominiert.
Vielleicht fragen Sie sich, warum ich Ihnen zum heutigen Hochfest diese Kunstpredigt halte. Ich meine, dass die beiden beschriebenen Darstellungen uns gut an das Festgeheimnis heranführen können. Wenn mich persönlich – und meine Brüder kennen mich – die barocke Szenerie letztlich mehr bewegt und meine Seele anrührt, so vermag die moderne Darstellung eine intensivere Auseinandersetzung mit deren Inhalt zu entfachen.
Fragen wir uns angesichts der Aufnahme Mariens in den Himmel doch einmal, wie wir uns den Himmel eigentlich vorstellen. Ist es der Garten Eden, ein Paradies, eine Art Schlaraffenland, ein Ort des Friedens und der Gerechtigkeit oder die Begegnung mit allen schon Verstorbenen?
Der Himmel – jeder hat vermutlich seine ganz eigene Vorstellung davon.
Wenn wir im biblisch-christlichen Sinn von Himmel sprechen, meinen wir das uns von Gott zugedachte Ziel der persönlichen und universalen Geschichte; also das endgültige, rundum beseligende „Aufgehobensein“ in der Gemeinschaft mit Gott. Himmel so verstanden ist ein anderes Wort für Vollendung.
„Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden“, hörten wir in der Lesung aus dem Korintherbrief. Quelle und Mitte aller Vollendung ist Gottes versöhnende Liebe, die uns in Christus bereits innergeschichtlich erschienen ist und im Himmel in ihrer ungehinderten Wirksamkeit offenbar wird. Der Seher Johannes nennt sie die Hochzeit des Lammes, die Gott mit seiner Schöpfung im himmlischen Jerusalem feiern will. „In dieses Fest wird all das mit einbezogen, was uns auch jetzt schon in unserem irdischen Leben mit dankbarer Freude erfüllt, was unsere mitlachende und mitweinende Sympathie weckt, ja, was uns einfach zutiefst menschlich sein lässt“, wie es Medard Kehl formuliert.
In unserer eigenen Vollendung sollen wir endgültig Ja sagen können, auch zu all dem Schmerzlichen, das erst im Licht der versöhnenden Liebe Gottes ganz und heil werden kann. Diesen Prozess der je eigenen Vollendung meinen wir im christlichen Glauben, wenn wir vom Himmel sprechen.
Was wir in der Lesung vom Hl. Paulus über die Vollendung aller Menschen hörten, sagt die Kirche in ihrem Lehramt nun eigens von Maria: „Die Gottesmutter ist derart in das Geheimnis Christi eingeschrieben, dass sie der Auferstehung ihres Sohnes mit ihrem ganzen Sein bereits am Ende ihres irdischen Lebens teilhaftig wird; sie lebt das, was wir alle am Ende der Zeiten erwarten, wenn der »letzte Feind«, der Tod, entmachtet werden wird.“
Die Begründung für die unmittelbare Aufnahme Mariens in den Himmel liefert uns der Lobgesang der Gottesmutter im Evangelium. Das Magnifikat ist eine einzige große Zustimmung zu Gottes Plan mit ihr. Maria spricht – schon während sie Christus in sich trägt – das endgültige Ja ihrer zukünftigen Vollendung und kann daher nach ihrem irdischen Leben unmittelbar am großen Fest der kommenden Welt teilnehmen. Durch all die Erfahrungen der Verlassenheit, in Schmerz und unsagbarem Leid, hat sie dieses einmal gegebene Ja nie zurückgenommen.
So ist die Gottesmutter uns Vorbild im täglichen Durchhalten, in der Treue und schließlich auch in der himmlischen Vollendung.
Das Leben der Gottesmutter, ihre alltäglichen Mühen und Sorgen, ihren Schmerz und ihr Leid bringt das Kunstwerk von Thomas Jessen in Drolshagen besser zum Ausdruck, zeigt es uns Maria doch als Menschen aus Fleisch und Blut, der an Christi Vollendung Anteil nehmen darf.
Die Treue der Gottesmutter, das ein Leben lang durchgehaltene, unbedingte Ja zu Gott, vermag dagegen den barocken Glanz der Asam-Szenerie zu erklären, wenn in dieser golden-lichtvollen Darstellung eine Ahnung unserer je eigenen österlichen Vollendung aufleuchtet.
Amen.