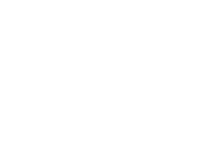von P. Johannes Sauerwald OSB
Angesichts der vielen ungelösten Probleme unserer Zeit könnte man sehr pessimistisch werden. Kann man etwa Spuren eines Wandels zum Positiven, die Verbesserung vielfältiger Störungen erkennen?
Wie groß waren doch die Erwartungen noch vor sechs bis acht Jahren, die die Menschen zu Protestaktionen auf die Straßen brachten! Im Jahr 2019 waren es in Deutschland ca. 1,5 Millionen! Diese Welle ebbte langsam ab, jetzt brennt sie nach vielen Rückschlägen auf internationaler Ebene nur noch auf kleiner Flamme. Wie kann man trotzdem Optimist bleiben?
In der Süddeutschen Zeitung vom vergangenen Dienstag machte sich ein Journalist darüber Gedanken und kommt zu dem Ergebnis: Wer nicht in Trübsinn und Schlechtmachen versinken will, sollte sich auf erfolgreiche Veränderungsprojekte in der Gegenwart konzentrieren. Das ist ein empfehlenswertes Verfahren, finde ich. Eigentlich tue ich viel zu wenig, um aufmerksam mutmachende Entwicklungen in Kirche und Gesellschaft zu verfolgen.
Vielleicht tut es in diesem Fall gut, sich das Entwicklungsprojekt „Reich Gottes“ gerade heute am Pfingstfest näher anzuschauen. Das Pfingstereignis hat, so das Neue Testament, in der Vergangenheit zur Zeit Jesu stattgefunden und findet heute kaum noch Beachtung. Aus dem Selbstverständnis unseres Glaubens aber ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass das Pfingstfest, die pfingstliche Bewegung, noch längst nicht abgeschlossen ist. Sie liegt immer noch auf der Lauer und sucht nach einer Gelegenheit, sich von neuem zu bewahrheiten.
Wir können die Geburtsstunde der Kirche nur verstehen, wenn wir berücksichtigen, dass der Glaube an die Präsenz des göttlichen Geistes schon über viele Jahrhunderte im Volk Israel ausdrücklich ins Wort gebracht worden ist. Durch Propheten wie Ezechiel, Jesaja und Joel z.B.: Die Überzeugung, dass die Schöpfung nach all dem vielen Bösen in der Welt auf das Wirken einer göttlichen Kraft wartete. Ezechiel fasst zu Beginn des 5. Jahrhunderts v. Chr. diese Erwartung in dem Heilsversprechen zusammen: „Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euer Inneres. Ich beseitige das Herz aus Stein aus eurer Brust. Ich lege meinen Geist in euch und gebe euch ein Herz aus Fleisch.“ (Ez 36, 26-28a) Diese Verheißung, dass ein Tag des Herrn kommen werde, hat der Glaube Israels trotz großer Enttäuschungen im Verlauf der Geschichte mit ihrem Auf und Ab weitergegeben und war auch z. Zt. Jesu lebendig.
Im NT erfüllt sich dieses Versprechen vom „Tag des Herrn“ am Pfingsttag mit der Ankunft des göttlichen Geistes. Das wird bildreich in der Erzählung der Apostelgeschichte geschildert. Der Hl. Geist wird mit „Sturmgebraus“ (so in einem Lied im alten Paderborner Gesangbuch „Sursum Corda“) und feurigen Zungen in die Herzen der Jüngerinnen und Jünger eingegossen, laut und machtvoll.
Waren die Jüngerinnen und Jünger darauf vorbereitet? Darüber macht die Bibel keine genauen Angaben. Wir wissen, dass sie Angst hatten vor den Feindseligkeiten der Gegner Jesu und das Haus dicht gemacht hatten. Die Jesusbewegung war wohl am Ende und doch hatten sie sich noch einmal getroffen. Das ist für mich erstaunlich. Wäre es nicht sicherer gewesen, die Gruppe aufzulösen, um Nachstellungen zu entgehen? Auch dieser Rest an Glut in der Asche war ein Ansatzpunkt für das Kommen des Heiligen Geistes.
Im Kontrast zur Darstellung in der Apostelgeschichte hören wir im Abschnitt aus dem Johannesevangelium (Joh 20, 19-23) von einem viel verhalteneren Vorgang der Geistausgießung: Jesus tritt in die verängstigte Schar seiner Anhänger, stellt sich in die Mitte, sozusagen als das geistige Zentrum ihrer Gemeinschaft, und grüßt sie mit den Worten „Der Friede sei mit euch!“. Dieser Gruß ist nach der letzten Papstwahl von Leo XIV ausgesprochen worden, das war das Erste, was er den versammelten Gläubigen auf dem Petersplatz und den Zuschauern auf der ganzen Welt wünschte.
„Friede“ – dieser Gruß aus dem Mund Jesu kommt dem nahe, was wir von ihm wissen und was er damit gemeint hat: die umfassende Einheit der Menschen untereinander, mit der ganzen Schöpfung und mit Gott. Wir kennen diesen Gruß aus der Liturgie, dort gehört er an manchen Stellen zum Ritus. In den Worten Jesu höre ich die volle Absicht, die bewusste Mit-Teilung, die Weitergabe dessen, was ihm am Herzen liegt, heraus. Wer diesen Frieden erfahren hat, kann und möchte ihn auch weitergeben. Manchmal müssen wir diesen Frieden in uns von neuem suchen, ihn wieder aufleben lassen, wenn er verdeckt wird, ihm Spielraum geben in unserem Denken und Handeln, und so die negativen Unterströmungen verscheuchen, die Keimzellen negativer Einflüsse, und unabgelenkt auf den Herrn schauen.
Das Besondere an dieser Art der Geistmitteilung im Johannesevangelium ist das Hauchen. Hier liegt der Akzent nicht auf der leidenschaftlichen Dynamik wie in der Apostelgeschichte, dem furchtlosen Auftreten, sondern auf der starken Kraft der Freude, die Rücksicht nimmt auf das Fassungsvermögen des Gegenübers, und auf das Vermögen, einen verschreckten Menschen in seinen Ängsten, Schuldgefühlen und Nöten zu erreichen. Wer sich gesandt weiß, wird eine direkte Sprache benutzen, damit die Wahrheit klar verstanden wird. Doch kommt es auch darauf an, sich der Situation der Ansprechpartner anzupassen.
Der Erzählung des Pfingstereignisses ist anzumerken, dass in den Jüngern eine Wandlung geschieht. Sie öffnen die Türen und sprechen offen aus, was in ihnen vorgegangen ist. Sie möchten die lebensspendende Kraft Gottes bezeugen. Man darf das auch „Glaubensoptimismus“ nennen. Er beinhaltet weniger eine Stimmung als den festen Willen, in das Geschenk des kommenden Gottesreiches aktiv einzutreten. Damit verbunden ist die Entscheidung, auch mitzumachen, in den vielen kleinen Alltagsvollzügen das zu tun, wovon man erfüllt ist, in den Momenten, in denen man anderen begegnet, miteinander spricht und seinem Nächsten Gutes tut. Auch wenn wir dabei Fehler machen, unsere Schwachheit spüren und von den Sorgen niedergedrückt werden: Das Pfingsterlebnis ist auch in der Gegenwart nachvollziehbar, denn der Geist Gottes wohnt in uns allen.