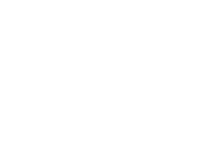von Abt Stephan Schröer OSB
Er ist anders, der erste Advent in diesem Jahr.
Meine Schwestern, meine Brüder,
wir hier in der Abteikirche sind eine kleine Schar. Und wahrscheinlich nicht alle in einer freudigen Erwartung, wie sie zum Advent gehört. Eher nachdenklich mag sich der eine oder andere fühlen, nicht frei von Sorgen und Unsicherheit.
Und draußen vor der Kirche. Es gibt keinen Adventsmarkt. Da gehen die Gedanken zurück in die vergangenen Jahre. Viele Menschen waren unsere Gäste, bekannte Gesichter, und solche, die voller Erwartung zum ersten Mal kamen. Sie kamen, um all das anzuschauen, was über lange Wochen von vielen hilfreichen Händen vorbereitet worden war, um zu probieren, das Gebäck, den Stollen, den Glühwein, die Gerichte aus unsere Küche, oder um schon etwas für das Weihnachtsfest zu kaufen. Um zusammen zu sitzen und zu sprechen, in der Oase, im Forum, vor der Kirche, im Laden. Und in den Einstimmungen in der Kirche zu spüren, wie schön diese Zeit sein kann, die auf das Fest der Menschwerdung führt. Eine Zeit der Begegnung, der Nähe, der Vorfreude.
Der erste Advent in diesem Jahr, er ist anders.
Die Pandemie hat die Vorzeichen gesetzt. Angesichts bedrohlicher Entwicklungen weltweit macht es Sinn, Regeln aufzustellen, Selbstverständliches einzuschränken, Abstand zu halten, Rücksicht aufeinander zu nehmen und manches zu streichen, was mit festlicher Nähe zu tun hat. Eine Situation, wie sie so für uns alle neu ist.
Und verständlich ist es, wenn viele in Sorge sind und Fragen haben: Wie wird es Weihnachten? Die Familie? Die Reisen? Wie lange geht das noch? Und wann wird die Möglichkeit bestehen, durch eine Impfung geschützt zu werden? Fragen, die uns auch heute Morgen umtreiben. Und wie feiern wir Gottesdienst angesichts dieser Fragen? Gottesdienst im Advent, dieser Zeit, die von Hoffnung und Erwartung geprägt ist und ja den Blick auf Weihnachten öffnen will, dieses Fest, das wie kein anderes mit gelungenem Leben zu tun hat.
Meine Schwestern, meine Brüder,
wir sollten es auf jeden Fall jetzt gemeinsam versuchen. Und es liegt nahe, die Texte zu befragen, die uns heute dabei begleiten. Am meisten berührt haben mich die Sätze aus dem Markus-Evangelium, kurz und einprägsam. Jesus im Gespräch mit seinen engsten Vertrauten, mit Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas. Und dann, als er von dem Türhüter erzählt und dessen Sorge, wenn der Hausherr auf Reisen ist, eine kurze Forderung, die an Intensität noch gewinnt, weil sie zweimal wiederholt wird: Gebt Acht und bleibt wach! Und dann: Seid wachsam! Und: Was ich aber euch sage, das sage ich allen: Seid wachsam.
Beim ersten Hören wirkt es wie die Einladung zu einer eigenen Pandemie-Predigt.
„Seid wachsam“, das ist die sinnvolle und verständliche Ermahnung der politisch Verantwortlichen. „Seid wachsam“: Das ist sicher auch das Wort derer, die den wissenschaftlichen Hintergrund erforschen und erklären und auf die Folgen des Corona-Virus verweisen. Eine solche „Pandemie-Predigt“ allerdings möchte ich nicht halten. Erst recht nicht, wenn ich daran denke, welche Fülle von Nachrichten uns täglich begleitet und uns auch wegen mancher Widersprüchlichkeit, Falschinformation und Polemik oft ratlos, verwirrt, auch hin und wieder aggressiv zurück lässt.
Eher bescheiden möchte ich fragen: Wie könnte unser Advent in diesem Jahr aussehen angesichts der Fakten, die unsere Zurückhaltung, unsere Ernsthaftigkeit und manche Einschränkung fordern. Manches ist anders. Und für manche ist es eine schwere Zeit.
Das Wort Jesu von der Wachsamkeit ist ja, wie wir eben gehört haben, an alle gerichtet, also auch an uns, die wir jetzt hier zusammen sind.
„Was ich aber euch sage, das sage ich allen: Seid wachsam!“
„Das sage ich allen.“ Eine Aufforderung, die alle erreichen will und die auch alle mittragen und weitertragen sollen. Und wenn ich zwischen den Zeilen lese und es richtig heraushöre, ist hier von einer Wachsamkeit die Rede, die nicht voller Angst erstarrt und nur die Vorschrift kennt und dass ich alles richtig mache. Nein, sie ist offen für Neues, für Überraschungen. Sie schaut voller Achtsamkeit hin und nimmt wahr, was alles möglich ist. Und sie ist aktiv. Sie ist eben voller Erwartung.
Also: Sei wachsam.
Wie kann das sein, in diesem Advent? Die Einschränkungen unseres Alltags schenken uns Zeit. Für manche ist es die Einladung, auszuruhen, durchzuatmen,
Kraft zu schöpfen. Das tut gut. Für andere ist es vielleicht die Einladung, zuhause aufzuräumen. Eine Sache, die noch so sinnvoll sein mag, aber in der Regel in der Begeisterung nicht von Dauer ist und oft von sehr beschränktem Erfolg. Oder es wird berichtet, dass Baumärkte ein unverhofftes Umsatzplus verzeichnen. Das deutet auf erheblichen Reparaturbedarf in den eigenen vier Wänden. Sicher, es wird auch manche geben, die sich langweilen, herumhängen und die Tage vertrödeln. Aber ich spüre, es bringt mich meiner Frage nicht näher, wie Wachsamkeit in diesem Advent Gestalt finden kann.
Es geht ja um Advent, übersetzt also um „Ankunft“. Advent, sprachlich ist das Wort verwandt mit dem englischen „Adventure“, was ja „Abenteuer“ meint. Advent hat mit Warten und Erwartung zu tun und damit mit Zukunft.
Und es geht um eine Ankunft besonderer Art. Es geht um die Gegenwart Gottes unter uns. Jetzt schon, in unserem Alltag. Menschwerdung Gottes… Das ist auf Aufbruch gestimmt, auf Neubeginn, auf Zukunft. Das hat mit unseren Tagen zu tun, mit unserem Leben. Und wenn ich das, was mich Weihnachten erwartet,
in aller Kürze umreißen soll, dann ist es dies: Das Staunen über diesen Gott, der sich um uns Menschen sorgt. Über diesen Gott, der uns nachgeht bis zur Menschwerdung. Über diesen Gott, der trotz aller Probleme und Katastrophen in unserer Welt, trotz manchen Leids vielleicht ganz in meiner Nähe, uns immer wieder deutlich macht, dass er uns nicht allein lässt. Sich von diesem Gott anrühren lassen, das ist Weihnachten. Und ihn zu erwarten, das ist Advent, ihn zu entdecken in meinen Tagen.
Es geht um diesen Jesus, der uns allen unsere Einmaligkeit und Würde zeigt und es ein Leben lang nicht lassen kann, von diesem neuen Leben zu erzählen und es zu teilen, und uns an unsere Möglichkeiten in der Kraft des Geistes Gottes zu erinnern.
Wenn ich auf diesen Advent schaue, der so anders ist, stiller als sonst und nachdenklicher, frage ich mich, ob das nicht auch eine Einladung sein kann, neu und einmal ganz anders über mein Leben nachzudenken. Wie könnte dieser Advent im Alltag für mich aussehen? Nicht, dass ich Ihnen Rezepte an die Hand geben möchte. Das würde mich überfordern. Und mit Sicherheit würde ich Dinge sagen, die sie nur langweilen. Noch dazu würde es Ihre Entdeckerfreude einschränken. Und das möchte ich nicht.
Ich möchte Sie nur einladen, Ihren Alltag neu in den Blick zu nehmen, unter adventlichen Vorzeichen. Vielleicht ist manches Gewohnte und Selbstverständliche einer neuen Aufmerksamkeit wert. Vielleicht hat manches mit dem Leben zu tun, das auf der Strecke geblieben ist.
Advent, geschenkte Zeit, um neu nachzudenken, über mich, ganz persönlich, mich zu erinnern an Dinge, die ich einmal begonnen und gern getan hätte, die aber im Alltagstrott untergegangen sind. Mal wieder mit Menschen, denen ich vertraue, in Ruhe zu sprechen, und mit solchen, mit denen es Streit gab, Versöhnung zu suchen. Schöne Dinge im Alltag neu zu entdecken, Musik, Bücher, das Erlebnis in der Natur. Neues auszuprobieren, schöpferische Begabungen zuzulassen oder ganz neu zu entdecken. Vielleicht wird es dann wirklich abenteuerlich.´Das alles hat mit meinem Leben zu tun.
Und vielleicht entdecke ich dann tief in meinem Herzen Spuren, die mit dem Advent, der Ankunft, der Ankunft Gottes in meinem Alltag zu tun haben. Advent mitten in meinem Alltag, mitten in meinem Leben, dass Gott dabei ist, schon jetzt. Ich glaube, gerade in diesen Zeiten, in denen ich mich schwer tue, weil manches nicht geht, oder wenn ich mich erschöpft fühle und getrieben, wenn ich mir selbst im Weg stehe und mich selbst nicht leiden kann, kann der Advent neu den Blick freigeben und schärfen und Neues möglich machen, was mit meinem Leben zu tun hat.
Mein Wunsch für uns an diesem ersten Advent ist, dass wir erfahren dürfen, dass Gott jetzt schon dabei ist, in unseren Herzen, damit das Unerwartete geschehen kann, und uns eine neue befreiende Sicht auf unseren Lebensweg geschenkt ist und von da auch ein offener Blick auf die Menschen, die mit uns leben, besonders für die, die es in diesen Tagen schwer haben, weil sie krank sind oder hilflos oder einsam sind und vielleicht ausgerechnet auf mich warten.
Vielleicht ist es auch ein Weg, neu Mut zu schöpfen in einer Welt, die ja in mancher Hinsicht bedroht ist, und Mut zu finden zum kritischen Blick und zu Schritten, die mit Frieden zu tun haben.
Meine Schwestern, meine Brüder,
ich wünsche Ihnen die Gegenwart Gottes in diesem Advent. Und erinnere noch einmal an das Wort des Apostels Markus von der Wachsamkeit. Vielleicht gibt es manches zu entdecken, was mit unserem Leben zu tun hat. Vielleicht können wir neu spüren, dass wir von Gott getragen sind.
„Habt acht! Bleibt wach! Seid wachsam!“