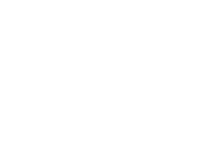Über Nebukadnezars Traum (Dan 2,1-23)
Ein König träumt. Dies ist der Dreh- und Angelpunkt der folgenden neunundvierzig Verse (Die zweite Hälfte folgt in der Leseordnung erst morgen).
Was heißt es, dass er träumt? Träume sind in der Hebräischen Bibel durchaus bekannt. Der Patriarch Josef träumt und wird dafür verspottet und nach Ägypten verkauft. Der Patriarch Jakob träumt und erkennt darin die Verbindung zu JHWH. Dies sind nur zwei Beispiele. Hier träumt jetzt – nicht weiter ungewöhnlich, weil auch der Pharao einen wahrsagenden Traum hat – ein heidnischer König und möchte sich den Traum deuten lassen.
Traum als Verbindung zum Göttlichen? Heute, für uns moderne Menschen doch etwas weit hergeholt. Andere Kultur, andere Zeit, anderes Weltbild. Ja, stimmt und das muss auch immer berücksichtigt werden. Darum ist die Erforschung der kulturellen Umwelt so wichtig und darf nicht vernachlässigt werden. Wir dürfen aber auch nicht einfach das, was da im Wortlaut steht, unhinterfragt und nicht kritisch reflektiert übernehmen. Das geschieht leider viel zu oft. Selbst höchste Stellen in Rom sind nicht immer vor einem solchen Fehler gefeit, wie man in der aktuellen Diskussionslandschaft leicht feststellen kann.
Aber muss es deswegen gleich alles als überholt abgeschrieben werden?
Der Begründer der Psychoanalyse, der Wiener Sigmund Freud hat 1900 ein Werk veröffentlicht, das sich mit Träumen beschäftigt: „Die Traumdeutung“. In seiner Zeit innovativ, eröffnete es die psychologische Erforschung von Träumen. Sein Freund und Kollege Carl Gustav Jung wandelte seine Gedanken ab und entwickelte – das führte dann auch zum Bruch zwischen beiden – seine eigene, Freud widersprechende Theorie der analytischen Psychologie. Wir sehen: Auch in der Moderne verlor das Thema nicht an Brisanz. Wo ist hier der Unterschied? Er liegt darin, woher die „Botschaften“ kommen. Sind es „Botschaften“ des Göttlichen oder „Botschaften“ des Unterbewussten, die sich Raum schaffen?
Immer noch besteht die Brisanz, wie ich mit solchen Texten umgehe.
- Nehme ich alles wortwörtlich?
- Versuche ich in alles einen wissenschaftlich belegbaren Kern hineinzudeuten – und sei es auch nur, indem ich ihn mit der Brechstange hineinpresse und damit den Text als literarisches Ganzes zerbreche?
- Schreibe ich es einfach als Mythos ab?
Alle drei Wege werden dem Text nicht gerecht.
Es geht, wie immer um einen Mittelweg, den es einzuhalten gilt.
- Ich darf nicht alles als Tatsachenbericht nehmen, denn es ist gelebte Erfahrung, die berichtet wird, keine Dokumentation, wie Filmaufnahmen.
- Ich darf den Text nicht so verbiegen, dass er seine Intention verliert – Das würde den Autoren nicht gerecht werden. Auch darf ich nicht das hinein quetschen, was ich als wissenschaftlich belegt erachte: Vielleicht ist es morgen schon überholt.
- Ich darf nicht alles als Mythos abtun, denn manchmal kann der Mensch die différance, die Differänz (Derrida) nur so ausdrücken.
Einen Text wahrnehmen, wie er ist – Das ist die Aufgabe. Eintreten in einen Dialog mit dem von Menschen in einer anderen Zeit geschriebenen Text: Das wahrnehmen, was mich irritiert, und das, was mich anspricht. Das wahrnehmen, was ich in genau diesem Augenblick als Botschaft wahrnehme, die mir der Autor vermitteln will. Alles kann sich wenig später geändert haben, aber vielleicht schlägt es in mir eine Saite an, die nachklingt. Vielleicht muss ich nicht verzweifelt raten, wie die Deuter im heutigen Abschnitt, sondern mir wird – wie Daniel – das klar, was vielleicht gar nicht ausgesprochen wurde. Das ist ein verborgener Traum, den es zu erraten gilt, um ihn dann zu deuten. Vielleicht ist es das, was Joseph von Eichendorff meinte, als er schrieb:
„Schläft ein Lied in allen Dingen,
Die da träumen fort und fort,
Und die Welt hebt an zu singen,
Triffst du nur das Zauberwort.“
Br. Symeon Müller OSB