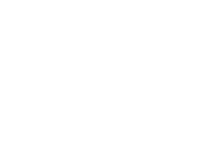von P. Abraham Fischer OSB
Ich kann mit dieser Kreuzigung nichts anfangen, sagte mir ein Freund, das Leben Jesu sei doch aussagekräftig und der Wanderrabbi Joshua sei auch ein beeindruckender Prediger gewesen. Aber dass Jesus sterben musste und dann noch diesen Tod, das entzog sich seiner Vorstellung. Und dass er das freiwillig getan habe, ohne Kampf, ohne Widerspruch, das befremde ihn. Ostern würde er auch gerne feiern, aber Karfreitag?
In der Rede vom guten Hirten geht es genau darum: Leben hinzugeben und das freiwillig.
Die Frage berührt die Menschen nicht nur im Bedauern um den Tod Jesu. Warum musste der Gottessohn sterben? Und warum musste er am Kreuz hingerichtet werden?
Sie berührt auch unser eigenes Leben. Früher betete man um einen guten Tod und nahm damit die Sterblichkeit des Lebens bewusst in den Blick. Und wir ahnen: Sterben ist loslassen, ausatmen, sein lassen. Für manche gehört ein Aufbäumen, ein Kampf dazu, andere willigen still ein und gehen hinüber. Das Geheimnis ist, dass Tod uns nicht einfach geschieht und wir eine Art Opfer sind, sondern dass jeder Mensch seinen Tod stirbt. Einzig die Tatsache, dass das Schicksal des sicheren Todes uns allen dräut, verbindet alle Menschen.
Welche Rolle nun spielt die Hingabe des Hirten Jesu in diesem Zusammenhang?
Was will uns Gott sagen?
Die alte Theologie schon hat sich diese Fragen gestellt und ihre Antwort versucht: Damit die Menschen gerettet werden, musste Gottes Sohn sterben. Es brauchte ein Opfer, das uns loskauft. Blut gegen Blut – Auge um Auge – Zahn um Zahn. Der Gedanke des Opfers, das sich freiwillig gibt, klingt auch in der Rede Jesu über den guten Hirten an. Er gibt das Leben für die Schafe. Und er gibt es freiwillig.
Das ist erst einmal ein starker Gedanke. Etwas nicht notgedrungen, nicht erzwungen tun, und dann gegen unser Wirtschaftsdenken: Er gibt sein Leben, ohne etwas dafür zu bekommen. Eine Nuance an dem Gedanken ist sehr wichtig: Jesus schenkt sich – opfert sich. Er wird nicht geopfert. Das ist passiv, wenn das Leben geraubt wird. Jesus bleibt aktiv. Er willigt innerlich ein – wenn auch in Angst, Zweifel und Einsamkeit.
Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu nehmen. Niemand entreißt es mir, sondern ich gebe es von mir aus hin.
Unser Verhältnis zum Leben ist ein anderes. Wir vertrauen dem evolutionären Lebenstrieb und gehen davon aus, dass wir unser Leben selber gestalten, dass wir unser Überleben sichern. Wir erleben uns als Besitzende des Lebens, wollen aktiv sein, was meint, dass wir das Leben festhalten und meinen, es zu bewahren.
Und im innersten Herzen wissen wir, dass wir es nicht verhindern können, das Sterben – unser Sterben. Wir tragen das Todesleiden an unserem Leib – sind und bleiben Kreaturen – Geschaffene, Abhängige, Sterbliche.
Es ist nicht zu verschweigen, dass wir Verlängerung und Hinauszögerung erforschen und organisieren.
Eine berechtigte Reaktion ist unser Forscherdrang, der Kampf um das Leben, alle Strategie, den Tod wenn schon nicht zu besiegen so doch hinauszuschieben oder gar auszublenden.
Jesus aber verdrängt nichts. Er sieht den Tatsachen ins Auge. Er ist eben ganz Mensch geworden, der einzig wirklich göttliche. Er begreift, wer er ist und was sein Auftrag wird: Hirte sein, der sein Leben hingibt. So sehr der Tod erschüttern mag, er ist ja doch nicht sinnlos. So sehr unser Tod uns auch verängstigen mag, ist er sinnlos?
Jesus musste sterben, weil der Tod zum Menschsein gehört. Der Schandtod am Kreuz, das ungerechte Urteil, all das vertieft seinen Tod. Er stirbt den sozialen Tod, indem er als Verbrecher hingerichtet wird, er stirbt den rechtlichen Tod, indem er verurteilt wird, und er stirbt den emotionalen Tod in der Angst am Ölberg, dem Verlassensein von den schlafenden Gefährten, und dann stirbt er auch den Tod allen Lebens.
Jesus stirbt alle Tode. Alle unsere Tode. Er ist wirklich Mensch geworden.
Jesus ist als Lebender schon in den Abgrund des Todes hinabgestiegen. Und sein Schicksal, mit der Menschwerdung auch dem Tode verfallen zu sein, trägt er durch bis ans Ende.
Zwei Kräfte nun setzt Jesus seiner Sterblichkeit entgegen: die erste ist die Hoffnung. Leben folgt einer andersartigen Logik, als der menschengemachte Individualismus. Leben ist Kollektiv.
Es gibt nicht das Einzelne, sondern nur das Größere, die Gattung, die Spezies. Dafür lohnt es sich zu leben und dafür lohnt sich auch die Hingabe des Lebens an die Nachkommen. Ein archaischer Gedanke, dass wir in unseren Kindern weiterleben. Wir sollten das nicht unterschätzen. Unser gesamtes soziales System beruht darauf. Der Generationenvertrag, die Fürsorge, der Stolz und die Freude, wenn das Leben in den Nachkommen wächst.
Und die zweite Kraft gegen die Sterblichkeit ist die Freiheit. Solange wir den Tod einfach ignorieren, verschaffen wir uns eine Fristverlängerung – ja.
Aber wir verknüpfen unser Dasein auch mit einer Angst, die im Dunkel lauert. Dumpf kann sie uns beherrschen, die Lebenshektik, nicht genug zu bekommen, raubt den Atem und macht das Herz eng.
Wir können uns von der Angst zum Tode nur befreien, wenn wir so frei werden, dass wir sie annehmen. – Ein großes Wort, ich weiß, und so schwer zu leben. Solange wir jung sind, scheint es leichter, wenn eben noch so viele Jahre vor uns liegen. Beginnt der Zeitvorrat aber zu schwinden, dann erwachen wir in einer verstörenden Realität.
Wenn wir Menschen also am Ende vor einer solchen Herausforderung stehen, dann macht es Sinn, sich bestens vorzubereiten und ganz schlicht und einfach zu üben.
In vielen alltäglichen Zusammenhängen erleben wir Endlichkeit und so etwas wie Tod. Wir können das annehmen als Übung für das große Loslassen. Wenn etwas nicht gleich klappt, wenn etwas so völlig quer läuft, das sind die Widerwärtigkeiten.
Das Hirtenamt – auch in der Kirche sollten wir uns diese Zusammenhänge immer wieder verdeutlichen, erklären und mit dem Lebensbeispiel nahebringen.
Jesus, der wahre Hirt der Kirche aber sagt uns:
Verbinden sich die beiden Kräfte Hoffnung und Freiheit, dann geschieht das Wunder, zu dem nur Menschen fähig sind: Wir teilen und spüren, dass wir reicher werden. Wir sterben füreinander, werden Brot für das Leben der Welt. Amen, seien wir es!