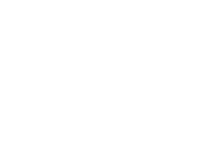von P. Klaus-Ludger Söbbeler OSB
„Passwort vergessen?“ – Ärgerlich ist das, wenn ich beim Arbeiten am Rechner den Zugang zu einem Programm oder einer Homepage brauche; schnell habe ich eingetippt, was mir als das zugehörige Passwort in Erinnerung ist und dann poppt auf: „Passwort vergessen?“. Meist war es nur ein leicht zu korrigierender Flüchtigkeitsfehler, manchmal ist aber auch ein lästiges Herumsuchen fällig, bis ich schließlich weiterkomme. Es fehlt das richtige, entscheidende Wort, damit etwas passiert, – das Passwort eben. Übrigens kein Phänomen, das erst mit der Digitalisierung aufgetaucht ist. Schon der alte Goethe kannte das, als er 1797 die Ballade vom Zauberlehrling schrieb: Immerhin kennt der Zauberlehrling das Passwort, um in Gang zu bringen, was er vorhat. Viele werden die Verse noch aus der Schulzeit kennen:
Walle! walle
Manche Strecke,
Dass, zum Zwecke,
Wasser fließe
Und mit reichem, vollem Schwalle
Zu dem Bade sich ergieße.
Damit wird der Besen zum Hausknecht, der das Wasser aus dem Brunnen holt, um das Bad für den ebenso vorwitzigen wie bequemen Herrn Zauberlehrling zu füllen. – Aber dann, oh Schreck: es fehlt das Wort, um das Ganze zu beenden, bevor das Haus völlig unter Wasser steht.
Stehe! stehe!
Denn wir haben
Deiner Gaben
Vollgemessen! –
Ach, ich merk es! Wehe! wehe!
Hab ich doch das Wort vergessen!
Ach, das Wort, worauf am Ende
Er das wird, was er gewesen!
In dieser humorigen Szene aus Goethezeiten spiegelt sich etwas, was mir in ziemlich ernsthafter Version in unserer augenblicklichen Corona-Bedrückung durch den Kopf geht. Es fühlt sich an wie „Passwort vergessen?“ oder Wehe! wehe! Hab ich doch das Wort vergessen! Ach, das Wort, worauf am Ende er das wird, was er gewesen!
Neben der konkreten Bedrohung für Leib und Leben durch das Corona-Virus zerrt an den Nerven, dass im Augenblick kein Mensch wirklich weiß, wann und wie das Ganze zu stoppen ist. Wir meinten, alles im Griff zu haben und jetzt haben wir die Kontrolle verloren! Unsere Gedanken und Gespräche, unzählige Äußerungen von Experten und Politikern behaupten alles Mögliche, aber bis jetzt hat keiner das Wort gefunden, mit dem wir Corona loswerden; wir stehen da wie Zauberlehrlinge: Herr, die Not ist groß! Die ich rief, die Geister, Werd ich nun nicht los.
Liebe Schwestern und Brüder,
Angesichts dieser, so möchte ich es einmal nennen, allumfassenden Wortfindungsstörung wirken die großen, souveränen Worte des Johannesprologs, die wir gerade als Evangelium gehört haben, wie aus der Zeit gefallen:
Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne es wurde nichts, was geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt.
Man ahnt: Diese Sätze hätten die Kraft zu wirken, wenn es gelänge, sich von ihnen ergreifen zu lassen. Doch klingen sie angesichts des Wortgedröhns um die Corona-Pandemie nicht „wie ein Märchen aus uralten Zeiten“? Das tut umso mehr weh, je mehr wir merken, wie sehr es gerade hier und jetzt auf solche „wirkenden Worte“ ankäme.
- Wie Zugang finden zu einem Wort, das nicht ins Leere geht, sondern etwas „werden“ lässt.
- Wie Zugang finden zu einem Wort, das nicht runterzieht und verdunkelt, sondern in dem „Licht und Leben“ steckt?
- Wie Zugang finden zu einem Wort, das nicht „von der Finsternis verschluckt wird“, sondern in der Dunkelheit leuchtet?
Die Antwort auf solche Fragen wird nicht so einfach zu finden sein wie ein Zauberspruch oder wie ein Computerpasswort. – Doch, warum sich nicht zumindest auf die Suche machen? Ist es nicht eine grundlegende Lebenserfahrung, dass sich die wirklich wichtigen Dinge Schritt um Schritt erschließen, wenn man mit ihnen lebt, statt nur über sie zu grübeln und zu reden? – Deshalb: Was wären nächste Schritte, um das Wort zum Wirken zu bringen, das uns aus dem lähmenden Gerede befreit und einen Weg weist, der weiterführt?
Ich schlage die Schrittfolge der „Stationen auf dem Wege zur Freiheit“ vor, die Dietrich Bonhoeffer Ende Juli 1944 aufschrieb, als ihm klar vor Augen stand, dass seine persönliche Situation in der Nazi-Gefangenschaft aussichtslos war. Ich glaube, diese Sätze haben wirklich die Kraft, als Widerhall des „Licht und Leben“ bringenden „Wortes“ zu wirken, von dem das Evangelium spricht. Bonhoeffer sieht vier Stationen auf dem Weg, der das „Wort, das am Anfang war“, Wirklichkeit werden lässt bringt. Er spricht von der „Zucht“, von der „Tat“, vom „Leiden“ und schließlich vom „Tod“:
Zucht.
Ziehst du aus, die Freiheit zu suchen, so lerne vor allem Zucht der Sinne und deiner Seele, dass die Begierden und deine Glieder dich nicht bald hierhin, bald dorthin führen. Keusch sei dein Geist und dein Leib, gänzlich dir selbst unterworfen, und gehorsam, das Ziel zu suchen, das ihm gesetzt ist. Niemand erfährt das Geheimnis der Freiheit, es sei denn durch Zucht.
Tat.
Nicht das Beliebige, sondern das Rechte tun und wagen, nicht im Möglichen schweben, das Wirkliche tapfer ergreifen, nicht in der Flucht der Gedanken, allein in der Tat ist die Freiheit. Tritt aus ängstlichem Zögern heraus in den Sturm des Geschehens nur von Gottes Gebot und deinem Glauben getragen, und die Freiheit wird deinen Geist jauchzend umfangen.
Leiden.
Wunderbare Verwandlung. Die starken tätigen Hände sind dir gebunden. Ohnmächtig einsam siehst du das Ende deiner Tat. Doch atmest du auf und legst das Rechte still und getrost in stärkere Hand und gibst dich zufrieden. Nur einen Augenblick berührtest du selig die Freiheit, dann übergabst du sie Gott, damit er sie herrlich vollende.
Tod.
Komm nun, höchstes Fest auf dem Wege zur ewigen Freiheit, Tod, leg nieder beschwerliche Ketten und Mauern unsres vergänglichen Leibes und unsrer verblendeten Seele, dass wir endlich erblicken, was hier uns zu sehen missgönnt ist. Freiheit, dich suchten wir lange in Zucht und in Tat und in Leiden. Sterbend erkennen wir nun im Angesicht Gottes dich selbst.