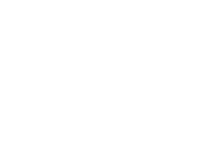von P. Marian Reke OSB
Römerbrief 8, 18ff. und Matthäusevangelium 13,1ff.
Das heutige Sonntagsevangelium gehört zu den längsten im Kirchenjahr. Es hat zwei Teile: das bekannte Gleichnis der Aussaat des Wortes vom Reich, das Jesus vor einer großen Menschenmenge erzählt, und die Deutung dieses Gleichnisses über die „Geheimnisse des Himmelreichs“ im kleinen Kreis seiner Jünger. Beides wird berichtet und erübrigt eigentlich eine zusätzliche Predigt. Die steht aber nun einmal an. Deshalb liegt es nahe, sich auch der Lesung aus dem Römerbrief zuzuwenden.
Der Ton, den Paulus im gesamten Römerbrief anschlägt, ist von existenzieller Wucht – wie in der Passage, die vorhin zu hören war. Ich nehme nochmals einige Worte auf, die das spürbar machen können. Er spricht von den Leiden der gegenwärtigen Zeit und von der Knechtschaft der Vergänglichkeit. Doch er tut es in der Perspektive der Hoffnung mit ähnlich starken Wortbildern: sehnsüchtiges Warten, Seufzen und in Geburtswehen liegen.
Kann uns das kalt lassen, was Paulus da aufdeckt: diese tiefe Solidarität in der Passion des Daseins? Seiner Einsicht nach teilen sie alle Geschöpfe, nicht nur die Menschen, auch Tiere und Pflanzen, alles was atmet – und atmet nicht alles, schwingt in unterschiedlicher Dichte wie die sogenannte leblose Materie?!
Passion des Daseins! – Passion meint zweierlei: Leidenschaft und Leidensgeschichte. Das bedeutet: beides hängt zusammen. Leidenschaft kann eine Leidensgeschichte zur Folge haben.
Weil die Liebe zum Leben seine Leidenschaft war, gestaltete sich der Weg Jesu nach und nach zu seiner Leidensgeschichte. In der öffentlichen Tischgemeinschaft mit Zöllnern und Dirnen, indem er Kranke auch am Sabbat heilte, Sündern bedingungslos vergab und gegen die religiösen Machthaber seiner Zeit für die Freiheit der Kinder Gottes eintrat, in alldem lebte er diese Liebe – bis zum Kreuz.
Jesus am Kreuz: das ist die Ikone der Passion des Daseins. Jahr für Jahr steht sie nach der Karfreitagsliturgie in der leeren Dämmerung der Apsis – ungewohnt schlicht, sehr still, ein einprägsamer Augenblick.
Auf der Höhe des Jahres können wir heute mit einem sonntäglichen Aufblick zur gewohnten, ganz anders gearteten Kreuzikone dieser Kirche den Alltag mit seinem oft irritierenden Themengestöber unterbrechen. Wir dürfen uns der Weite jenes Horizontes vergewissern, den Jesus von Nazareth mit seiner Reich-Gottes-Botschaft im Sinn hatte, wenn er wie im heutigen Evangelium von den „Geheimnissen des Himmelreichs“ sprach.
Die üblichen Assoziationen zum „Wort vom Reich“, wie Matthäus es nüchtern nennt, gehen jedoch fehl in der Annahme, damit sei vor allem eine Art Herrschaftsgebiet gemeint, das ein- und ausgrenzt. Machtkategorien verraten bis heute das Herzstück dieser Botschaft.
Reich im Sinne Jesu meint einfach Reichweite – eine Reichweite, die Horizonte eröffnet und keine Grenzen schließt. Ein Horizont ist ja eine buchstäblich vorläufige Grenze, die vor denen, die auf ihn zugehen, zurückweicht und so über sich hinaus weiterführt. Weiter – nicht nur linear verstanden, sondern räumlich.
Der offene Himmel über dem See Genezareth, unter dem Jesus Menschen sammelt, atmet diese Weite und hat ihn im Wortsinn „inspiriert“ als ein Gleichnis für den Atemraum einer je größeren Liebe. In ihr kann die menschliche Haltung des Liebens ihren inneren Halt finden, um sich im liebenden Verhalten zu äußern. Diese Inspiration bildet das Herzstück der Verkündigung Jesu, die von dort ihren Ausgang nimmt, um die Vielen aufzuerwecken – zur Solidarität in der Passion des Daseins, nicht nur der Menschen, sondern der gesamten Schöpfung!
Was will und soll sie das für uns bedeuten? Wir können annehmen, dass unsere doppeldeutige Lebenspassion in dem Erlebnis der Trennung von der Mutter wurzelt, mit dem wir zur Welt kommen. Die biologische Geburt – ihr Trauma – weist in Bedeutung und Wirkung über das körperliche Geschehen hinaus auf die seelische und geistige Ebene. Der Mensch erlebt sich nicht nur am Anfang, sondern immer wieder als getrennt: getrennt von seinen Mitmenschen und seiner Umwelt, getrennt von den Sinnquellen des Daseins, von Gott und wie in einem inneren Zwiespalt irgendwie getrennt auch von sich selbst.
Diesem Erleben des Getrenntseins liegt jedoch etwas zugrunde – die Erinnerung an eine Einheit, ohne die Trennung gar nicht als solche denkbar und erfahrbar wäre. Wir verdanken unser Dasein auch einem Bruch, weshalb zeitgenössische Theologie von der „Gnade des Bruchs“ sprechen kann.
Wie lässt sich das verstehen? – Ich spreche einfach von mir selbst, denn ich kenne das Gefühl der Bruchstückhaftigkeit in vielerlei Hinsicht: immer wieder reibe ich mich an meinen Ecken und Kanten wund oder verletze damit andere. Ich denke, das gilt auch gegenseitig. Aber ist das schon alles? Gerade über die Bruchkanten könnten wir doch auch wahrnehmen, dass wir als Menschen zueinander gehören und darüber hinaus zu etwas, das mehr ist als wir alle zusammen – ein nicht mehr und noch nicht gegebenes Ganzes, dessen Teile wir sind.
Das ist doppelt zu spüren – als Verlust von Einheit und als Sehnsucht nach Zugehörigkeit. Gilt das nicht auch in Gegenseitigkeit?! Führen uns dieser Verlust und diese Sehnsucht nicht in die vielfältigen Lebensweisen des Mit-ein-anders – wie anschaulich doch die Sprache ist! – des Mit-ein-anders von Partnerschaften, Familienformen, auch klösterlichen Gemeinschaften und was es sonst noch gibt. In all diesen oft mühsamen Lebensweisen könnte sich unsere Bruchstückhaftigkeit als die Chance zu gegenseitiger Ergänzung erweisen – einer Ergänzung, deren ein jeder, eine jede von uns zugleich bedürftig und fähig ist.
Ein Letztes: Unsere Bruchkanten passen allerdings nicht nahtlos zu- oder gar ineinander. Es bleiben Lücken und sie sollten auch bleiben – als stete Herausforderung, diese Lücken in liebender Haltung und liebendem Verhalten zu überbrücken. Doch nicht nur das, sondern auch und mehr noch sollten die Lücken bleiben, weil sie den Grund durchschimmern lassen, auf den alles ankommt – nämlich jene göttliche Liebe, die unser menschliches Lieben erst möglich macht, es in Gelingen und Scheitern trägt und es vollendet. Diesem Grund dürfen wir vertrauen. Wir können uns auf ihn verlassen und müssten nicht immerzu an uns festhalten. Warum nur fällt das so schwer?!
Das Jahr steht auf der Höhe – so singen wir zum Schluss (GL 465). Der evangelische Pfarrer Detlev Block, der ein Dichter war, hat dieses Mittsommerlied 1978 geschrieben. Ihn bewegte die Frage: „Welchen Trost, welche Ermutigung gibt es für uns, wenn der Schatten des Wechsels und der Vergänglichkeit auf uns fällt?“ Der Kreislauf der Jahreszeiten spiegelt für ihn gleichsam, was auch unserem Leben insgesamt beschieden ist. Auf Blüte und Reife folgt die Ernte, dann setzt in der Natur das herbstliche Sterben ein und bisweilen liegt über Winterlandschaften eine Art Totenstille. Sonntag für Sonntag sind wir eingeladen, im Hören des Wortes und im Brotbrechen den Glauben zu nähren, dass unsere Lebenszeit aufgehoben ist in Gottes Ewigkeit, aus der wir stammen und in die wir heimkehren. Darauf dürfen wir vertrauen – mit anderen Worten: darauf können wir uns verlassen und müssen nicht an uns festhalten.