Predigt am Zweiten Adventssonntag (5.12.2021)
von P. Maurus Runge OSB
Es ist die geballte Macht der Weltgeschichte, die uns da in den ersten Zeilen des heutigen Evangeliums begegnet: der Kaiser Tiberius in Rom, sein Statthalter Pontius Pilatus in Judäa, die Führer der verschiedenen Provinzen, die Hohepriester als religiöse Führer. Sie alle sind vielfältig miteinander verwoben, bestimmen über Wohl und Wehe der einfachen Leute, sagen, wo es langgeht, sitzen in den Städten, den Zentren und Schalthebeln der Macht. Sozusagen eine antike Ministerpräsidentenkonferenz.
Dann aber ein Perspektivwechsel. Aus den Städten werden wir in die Wüste geführt, und hier ereignet sich Entscheidendes: „Da erging in der Wüste das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias.“ Kein Herrschertitel wird genannt, kein Zentrum der Macht, dieser Johannes ist nur der unbedeutende Sohn eines einfachen Priesters im Tempel. Und doch hat Gott mit ihm Großes vor, ereignet sich an ihm und mit ihm Heilsgeschichte, Verbindung von Altem und Neuem.
Wüste, das ist zunächst einmal ein lebensfeindlicher Raum, ein Ort, wo ich um mein Überleben kämpfen muss, wo ich in die Entscheidung geführt werde, was wirklich zählt im Leben. Wüste – das ist der Ort der Dämonen, der Lebensfeinde meines eigenen Inneren, der „logismoi“, wie es die Väter nennen, der „Gedanken“, die mich hin- und herziehen, so dass ich innerlich und äußerlich keine Ruhe finde, ein Getriebener bin. Sie kennen sicher die bekannte Darstellung des hl. Antonius im Dämonenkampf auf dem Isenheimer Altar. Wüstenzeiten sind immer auch wüste Zeiten.
Wüstenzeiten – wüste Zeiten – die erleben wir auch heute, bei uns. Die Corona-Pandemie, die noch lange nicht überstanden ist, hat uns und unser Selbstverständnis, auch unser kirchliches Selbstverständnis erschüttert. Es geht um Leben und Tod, und es kommt dabei auf das Verhalten jedes Einzelnen an. In Wüstenzeiten klärt sich so einiges, da scheidet sich Richtiges vom Falschen, und Unwichtiges entlarvt sich als das, was es ist: eben nicht überlebenswichtig. Und Menschen, von denen wir meinen, dass wir sie gut kennen, offenbaren auf einmal ganz andere Seiten. Werden sich unsere Kirchen einmal als überlebenswichtig, als „systemrelevant“, erweisen? Bei so manchen innerkirchlichen Diskussionen habe ich da so meine Zweifel.
Und mitten in diese Wüstenzeit ruft uns Johannes, die „Stimme aus der Wüste“, entgegen: „Bereitet den Weg des Herrn!“ Und er verkündet „die Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden“. Es ist ein durch und durch adventlicher Ruf, der viel mehr mit dem eigentlichen Advent, dem Kommen Gottes in unsere Welt, zu tun hat als Lichterglanz und Glühweinduft. Umkehr – das griechische „Metanoia“ – meint keine bloß moralische Umkehr, sondern eine Kehrtwende, einen Wechsel der Perspektive, der mir zeigt, was wirklich wichtig ist. So wie Baruch in der Lesung das Volk Israel auffordert, die Perspektive zu wechseln: „Steh auf, Jerusalem, und steig auf die Höhe.“ Umkehr, die Änderung der Perspektive, hat also etwas mit Bewegung zu tun. Ich muss mich auf den Weg machen, einen manchmal anstrengenden Aufstieg hinter mich bringen. Jeder, der wie ich gerne wandert, weiß, dass so ein Aufstieg ziemlich schweißtreibend sein kann. Man kommt leicht außer Atem, muss sein Tempo anpassen, auch mal Pause machen, aufatmen. Aber wenn ich dann meinen Atemrhythmus und mein individuelles Tempo gefunden habe, dann geht es sich gleich viel einfacher. Bei Wanderexerzitien pflegen wir oft zu sagen: „Jeder geht sein Tempo!“ Wandern ist in diesem Sinne kein Marschieren im Gleichschritt, sondern ein sehr individuelles Geschehen, bei dem jede und jeder den eigenen Rhythmus finden muss. Und doch ist es bei aller Individualität wichtig, aufeinander Rücksicht zu nehmen – so ist es wichtig, dass die, die ein schnelleres Tempo gehen, bei Weggabelungen warten und dann nicht sofort wieder weitergehen, wenn alle da sind, sondern den Langsamsten der Gruppe bestimmen lassen, wann es weitergeht.
Nur so werden, wie die Verheißung am Ende unseres Evangeliums lautet, wirklich „alle Menschen das Heil Gottes schauen“, oder, um im Bild des Wanderns zu bleiben, auf dem Gipfel ankommen – jeder in seinem Tempo, aber doch in gegenseitiger Rücksicht und Hilfestellung. Vielleicht auch ein hilfreiches Bild in unserer derzeitigen gesellschaftlichen Situation.
In diesem Sinne wünsche ich uns einen Advent, in dem wir unseren je eigenen Rhythmus finden, um dem Herrn, der uns entgegenkommt, den Weg zu bereiten. Und in dem die Schnelleren auf die Langsameren warten, die Langsameren aber auch ihre Schwäche nicht ausnutzen. Nur gemeinsam kommen wir zum Ziel, auf das wir zugehen. AMEN.
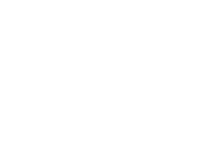
 Pixabay
Pixabay Pixabay
Pixabay


 Pixabay
Pixabay Pixabay
Pixabay Pixabay
Pixabay

 Pixabay
Pixabay Pixabay
Pixabay