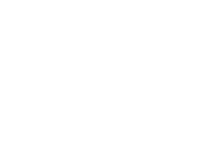von P. Werner Vullhorst OSB
„Die Renten sind sicher!“ – dieser Ausspruch Norbert Blüms von 1997 ist seit Freitag, seinem Sterbetag, immer wieder zu hören.
Einen ähnlichen Klang hatte die Aussage von Kanzlerin Merkel 2008, als sie inmitten der Finanzkrise ausdrücklich sagte: „Die Spareinlagen sind sicher!“ Beidesmal folgte Zweifel!
Seit Anfang März diesen Jahres ist sterotyp mal aus Berlin, mal aus Brüssel zu hören: „Die Versorgung mit Lebensmitteln ist sicher“ – denn die Hamsterkäufe waren da ein erstes Indiz dessen, was dann kam…
Ab Mitte März breitete sich europaweit und bald weltweit der große Shutdown angesichts der grassierenden Coronapandemie aus.
Seitdem begleitet uns dieses Wort, welches wir vorher nicht auf dem Schirm hatten: „Shutdown“ – und in Erweiterung das Wort „Lockdown“.
Der Shutdown bedeutet eine Situation, wie wir sie uns – als wir die diesjährige Fastenzeit begannen – noch nicht hätten vorstellen können. Per staatlicher Verfügungen wurden in kurzer Zeit das öffentliche und das private Leben in ungeahnter Weise heruntergefahren – nach und nach fast weltweit.
„Der unausweichliche Prozess der Globalisierung hat anscheinend seinen Höhepunkt erreicht: Jetzt zeigt sich die globale Verwundbarkeit der globalisierten Welt.“ So deutet der tschechische Soziologieprofessor und Priester Tomas Halik das, was sich zur Zeit ereignet.
Die Pandemie und der Shutdown sind zu zwei Seiten einer Medaille geworden.
Was hier gesellschaftlich und vielfach auch persönlich existenziell geschieht, erfahren Menschen besonders, wenn der Tod in ihr Leben einbricht. Im Tod bricht nicht nur das einzelne Lebensgefüge eines Sterbenden zusammen, sondern vielfach das von Partnerschaften, Familien, Freundschaften und manchmal das von großen menschlichen Gefügen.
Auch wenn hier in der Kirche die Osterkerze brennt und das Halleluja diesen liturgischen Raum erobert hat, so ist doch in unserer Gesellschaft für unzählige Menschen ein fortwährender Karfreitag mit Arbeitslosigkeiten, Insolvenzen und Zukunftsängsten geblieben.
Ging es nicht auch „Simon Petrus, Thomas, genannt Didymus – Zwilling -, Natánael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei anderen von seinen Jüngern“ ebenso?
Sie fanden sich am See von Tiberias wieder, weil am Karfreitag in Jerusalem mit Jesus auch ihre Lebensperspektiven starben. Der Grund, warum sie drei Jahre zuvor am See von Tiberias ihre Boote und Netze hatten liegen lassen, war tot und damit auch ihr Glaube an den neuen Weg.
Die Jünger fingen wieder von vorn an mit dem, was sie konnten – und das hieß: „Ich gehe fischen“. Kein Startup-Erlebnis, sondern ganz nüchtern hieß es gerade im Evangelium: „aber in dieser Nacht fingen sie nichts.“ Ihr persönlicher Shutdown hielt also noch an!
Die Erfahrung von Ostern scheint nicht immer nach dem liturgischen Kalender zu verlaufen, wie auch unsere Tage zeigen…
Der Karfreitag kann unerträglich lang werden, wie sich gegenwärtig gesellschaftlich zeigt und nun die große Solidarität, die wir vor Wochen noch hatten, heftige Risse bekommt und der Blick auf den eigenen Kuchen zunimmt. Die globalisierte Speisekammer scheint gefühlt schneller leer zu werden als gedacht.
Und Karfreitagsaugen werden irgendwann trüb:
„Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war.“
Auf die Frage nach ihren messbaren Erfolgen kam nur die knappe Antwort: „Nein“!
Nun macht der Nichterkannte den Jüngern mit der Verheißung Mut, es nochmals zu versuchen: Ihr könnt das! Ihr werdet etwas fangen!
Vergemeinschaftet kann das dann heißen: „Wir schaffen das…“
Und siehe, zu was Menschen in der Lage sind, wenn sie erneut anpacken…
Siehe da, wenn Menschen aus dem Nichts als Trümmerfrauen Städte aufbauen oder als Optimisten blühende Landschaften schaffen. Manchmal ist es unglaublich, was Menschen erreichen, wenn sie Verheißungen vertrauen: der Überfluss droht die Netze zu zerreißen und die Zahl 153 – von der ich weiß, dass sie auch eine mystische Bedeutung haben kann – klingt wie steigende Börsenkurse.
Ihren Erfolg wertschätzt Jesus, indem er ihnen sogar sagt: „Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt.“
Heißt das nicht, dass unsere Aufbaukräfte gut sind, dass Erfolge nicht fromm missachtet werden dürfen und Optimismus unschätzbar ist…
Der Nachtrag des Johannesevangeliums, der exegetisch das 21. Kapitel darstellt, und der damit zu einer Zeit entstanden ist, als die Kirche, als das Werk der Jünger schon etliche Jahrzehnte wuchs und vermutlich auch erfolgreich war, spricht von einer anderen Speise, die ihnen entgegenkommt und schon längst da ist, als sie an das neue Ufer kommen. Nicht Brot und Wein wie in Emmaus – denn die junge Kirche feiert schon längst die Eucharistie in den Häusern – sondern Jesus hat für die Jünger die zu diesem Zeitpunkt entscheidende Nahrung selbst bereitet:
Zu erkennen in einem Kohlenfeuer, auf dem Fisch und Brot sind.
Das Kohlenfeuer – kann es nicht sprechen von dem brennenden Dornbusch und dem Gott, der sagt „Ich bin der ich bin“?
Und Fisch und Brot – sind es nicht die Gaben der Brotvermehrung, wo Christus gegenwärtig ist, wenn zwei oder drei sich in seinem Namen versammeln, um das Brot und den Fisch, die „Gaben der Erde und der menschlichen Arbeit“, miteinander zu teilen?
Spricht an diesem dritten Ostersonntag 2020 die Gottesgabe auf dem Kohlenfeuer seiner Gegenwart vielleicht von der Gottesgabe der Geschwisterlichkeit und damit von der Gabe, welche die Pandemie verhindert, die laut Papst Franziskus noch schlimmer ist: der „Virus des gleichgültigen Egoismus“.
„Die Versorgung mit Lebensmitteln ist sicher“ – der Satz stimmt, wenn wir globale Geschwisterlichkeit als Anstiftung unseres gegenwärtigen Gottes leben.