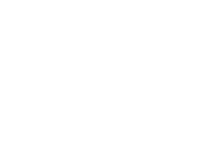31 Jesus versammelte die Zwölf um sich und sagte zu ihnen: Siehe, wir gehen nach Jerusalem hinauf; und es wird sich alles erfüllen, was bei den Propheten über den Menschensohn geschrieben steht. 32 Denn er wird den Heiden ausgeliefert, wird verspottet, misshandelt und angespuckt werden 33 und man wird ihn geißeln und töten und am dritten Tag wird er auferstehen. 34 Doch die Zwölf verstanden das alles nicht; der Sinn der Worte war ihnen verschlossen und sie begriffen nicht, was er sagte.
(Lk 18,31-34 – ganze Tageslesung: Lk 18,31-43)
In den Tageslesungen aus dem Lukasevangelium machen wir heute einen großen Sprung und gehen direkt ins 18. Kapitel, wo Jesus den Jüngern sein Schicksal vorhersagt – Leiden, Auslieferung, Verspottung, Misshandlung, Tod. Es wird ernst. Der Konflikt mit den religiösen Autoritäten, von dem wir in der Tageslesung gestern gehört haben, spitzt sich zu. Dass Jesus auch von der Auferstehung spricht, scheinen die Jünger vor lauter Leidensweissagungen gar nicht mehr zu hören.
„Doch die Zwölf verstanden das alles nicht.“ Wie sollten sie auch? Ein Messias, der durch das Leiden hindurchgeht, das war für sie jenseits aller Vorstellungskraft. Indem sie Jesus auf seinem Leidensweg begleiten, müssen sie noch einen langen und auch schmerzhaften Lernprozess durchmachen.
Und wie ist es mit mir? Verstehe ich Jesus? Oft geht es mir, wenn ich ehrlich bin, so wie den Jüngern. Ich verstehe das alles nicht. Es erschließt sich mir kein Sinn. Es ist wohl so wie mit den Jüngern. Ich muss mit Jesus mitgehen, ihn auf dem Weg seiner Passion begleiten, an seiner Seite sein – um vielleicht nach einem langen Lernprozess besser begreifen zu können.
P. Maurus Runge OSB