Predigt am 27. Sonntag im Jahreskreis (03.10.2021)
von P. Maurus Runge OSB
In den letzten Tagen war in der politischen Diskussion rund um die Regierungsbildung in unserem Land viel von einer verbindenden Vision die Rede, die es braucht, um gemeinsam in die Zukunft zu gehen. Wenn die fehlt, dann verliert man sich schnell im Kleinklein des Alltags und im Geschacher um Posten und Ämter, und die verschiedenen Parteien versuchen, sich gegenseitig auszuspielen – daran sind die Koalitionsverhandlungen 2017 letztlich gescheitert. Ich halte es für ein gutes Zeichen, dass zunächst miteinander gesprochen wird, um solch eine Vision auszuloten, ohne dass Inhalte direkt an die Öffentlichkeit weitergegeben werden.
Wenn wir uns die heutigen Lesungen, vor allem das Evangelium, anschauen, dann kann zunächst der Eindruck entstehen, dass wir es hier mit vielen Regelungen rund um Ehe und Scheidungsrecht zu tun haben, die allein für sich genommen einer legalistischen Praxis Vorschub leisten, die wenig hilfreich in der heutigen Vielfalt und Buntheit unserer Lebenswelt ist, ja, die auf viele Menschen verletzend gewirkt hat. Die Vision, das verbindende Element scheint da zu fehlen.
Im ersten Satz der Lesung entdecke ich ein Vorzeichen, unter dem die einzelnen Regeln und Vorschriften gelesen werden können und das uns zeigt, wo die größere Richtung ist, die Vision, die Gott mit seiner Schöpfung hat: „Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm ebenbürtig ist.“
„Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist.“ Der Mensch ist von Natur aus ein Wesen, das auf Gemeinschaft hin angelegt ist. Experimente zeigen, dass Kinder, denen am Anfang ihres Lebens diese Dimension vorenthalten ist, in ihrer späteren Entwicklung schwere Defizite aufweisen. Vielleicht stellt Jesus im Evangelium auch deshalb ein Kind in die Mitte der Jünger, um auf diesen Aspekt aufmerksam zu machen. Denn Kinder sind ja in vielem, was Gemeinschaft und das Zusammensein mit anderen angeht, noch unbefangener als wir Erwachsenen. Wenn wir die Vorschriften zur Ehe und das Verbot der Scheidung unter diesem Vorzeichen der Gemeinschaft und der Ebenbürtigkeit lesen, bekommen sie gleich einen ganz anderen Klang – nämlich Leben, Beziehung auf Augenhöhe zu ermöglichen und Einsamkeit zu bekämpfen.
Im Oktober begeht die Kirche den Monat der Weltmission. Sie nimmt einen Aspekt von Gemeinschaft in den Blick, der in ihrem Wirken und in ihrem Sein fundamental ist: eine weltweit vertretene Gemeinschaft von Gemeinschaften zu sein, die in einer gemeinsamen Vision – Jesus würde vom „Reich Gottes“ sprechen – miteinander verbunden sind. Es ist eine Gemeinschaft, die nicht gleichmacherisch ist, sondern die Vielfalt der Menschen und Kulturen anerkennt. Jeder, der schon einmal an einem Gottesdienst in Afrika teilgenommen hat, wird wissen, wovon ich spreche. Unsere Kongregation der Missionsbenediktiner wollte von Anfang an Gemeinschaften – Klöster – gründen, in denen gemeinsam das Lob Gottes gefeiert wird und die gerade so durch ihre Präsenz unter den Menschen missionarisch wirken und Glauben verkünden. In einer Programmschrift von Andreas Amrhein, dem Gründer der Missionsbenediktiner, heißt es dazu: „Heller und höher und wärmer loht das Feuer der Andacht, wenn viele Flammen vereint brennen als ein einzelnes Flämmchen. Feierlicher strahlt der Altar im Lichtglanz vieler Kerzen, als im Scheine einer Lampe oder Kerze.“ Das gilt übrigens nicht nur im kirchlichen Kontext: gerade heute, am „Tag der deutschen Einheit“, erinnern wir uns an die vielen Menschen, die friedlich, mit brennenden Kerzen in ihren Händen, vor 30 Jahren für Freiheit und Demokratie auf die Straße gegangen sind.
Aber auch der zweite Satz aus der Vision Gottes mit seiner Schöpfung vom Anfang der Lesung ist wichtig: „Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm ebenbürtig ist.“ Gemeinschaft wird immer dann scheitern, wenn diese Ebenbürtigkeit der Menschen, ihre fundamentale Gleichheit, ihre gemeinsame Würde als Ebenbilder Gottes nicht geachtet wird. Da mag sie noch so oft eingefordert werden, es werden hohle Phrasen bleiben, die nicht mit Leben gefüllt sind. An dieser fehlenden Ebenbürtigkeit sind die ersten Koalitionsverhandlungen 2017 gescheitert. Und die Folgen davon, wenn Menschen sich abgehängt fühlen, wenn sie sich nicht ernst genommen fühlen, spüren wir 30 Jahre nach der Wiedervereinigung Deutschlands sehr genau. Auch auf der Missionsgeschichte der Kirche liegt ein Schatten, wenn ganze Völker in ihrer Kultur nicht geachtet wurden, wenn ihnen in imperialistischer Manier ein europäisches Christentum aufgezwungen werden sollte, wenn selbst Missionare, die doch die Liebe Gottes verkünden sollten, nicht frei waren von rassistischen Ressentiments anderen Menschen gegenüber. Rassismus ist nicht nur ein Problem bestimmter gesellschaftlicher Gruppen, sondern offenbart sich oft erschreckend banal in meinem eigenen Denken und Handeln, in meiner Sprache. Und dass wir generell in unserer Kirche in puncto Ebenbürtigkeit noch einen weiten Weg vor uns haben, zeigen die Diskussionen um den Synodalen Weg: wenn eine Gruppe qua Amt ein Vetorecht hat und alles sofort blockieren kann, und sei es nur mit dem Verweis auf Rom, dann kann man zu Recht das dahinterliegende System in Frage stellen.
Diese realen Bruchstellen von Gemeinschaft können uns in die Resignation führen oder zynisch werden lassen. Sie können aber auch Antrieb sein, sich jetzt erst recht für eine Gesellschaft und Kirche zu engagieren, wo Menschen ebenbürtig miteinander umgehen. Und so möchte ich am Ende Amanda Gorman zu Wort kommen lassen, die junge Lyrikerin, die bei der Amtseinführung von Joe Biden Anfang des Jahres ihrer Nation, ja der ganzen Menschheit eine Vision aufgezeigt hat, die uns leiten kann, wenn wir vor lauter Legalismus und Resignation den Weg nicht mehr sehen. Sie schreibt:
Wir sind alles andere als lupenrein,
alles andere als makellos,
aber das bedeutet nicht, dass wir danach streben,
eine Gemeinschaft zu bilden, die perfekt ist.
Wir streben danach, gezielt eine Gemeinschaft zu schmieden.
Ein Land zu bilden, das sich allen Kulturen, Farben, Charakteren und menschlichen Lebensverhältnissen verpflichtet fühlt.
Und so erheben wir unseren Blick nicht auf das, was zwischen uns steht,
sondern auf das, was vor uns steht.
Wir schließen die Kluft, weil wir wissen, dass wir, um unsere Zukunft an erste Stelle
zu setzen, zuerst unsere Unterschiede beiseitelegen müssen.
Wir legen unsere Waffen nieder,
damit wir unsere Arme nach einander ausstrecken können.
Wir wollen Schaden für keinen und Harmonie für alle.
Lasst die Welt, wenn sonst auch nichts, sagen, dass dies wahr ist:
Dass wir, selbst als wir trauerten, wuchsen
Dass wir, selbst als wir Schmerzen litten, hofften
Dass wir, selbst als wir ermüdeten, es weiter versucht haben
Dass wir für immer verbunden sein werden, siegreich
Nicht weil wir nie wieder eine Niederlage erleben werden,
sondern weil wir nie wieder Spaltung säen werden.
[…]
Wenn der Tag kommt, treten wir aus dem Schatten heraus,
entflammt und ohne Angst.
Die neue Morgendämmerung erblüht, wenn wir sie befreien.
Denn es gibt immer Licht,
wenn wir nur mutig genug sind, es zu sehen,
wenn wir nur mutig genug sind, es zu sein.
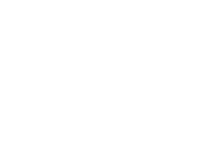
 CC Franken
CC Franken


 Roman Weis
Roman Weis
 pixabay
pixabay CC Franken
CC Franken


