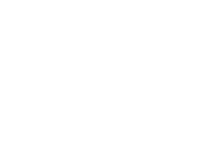von P. Marian Reke OSB
Bild: Ari
Lesung aus dem Buch Jesaja 66, 10–14c
Freut euch mit Jerusalem und jauchzt in ihr alle, die ihr sie liebt! Jubelt mit ihr, alle, die ihr um sie trauert, auf dass ihr trinkt und satt werdet an der Brust ihrer Tröstungen, auf dass ihr schlürft und euch labt an der Brust ihrer Herrlichkeit! Denn so spricht der Herr: Siehe, wie einen Strom leite ich den Frieden zu ihr und die Herrlichkeit der Nationen wie einen rauschenden Bach, auf dass ihr trinken könnt; auf der Hüfte werdet ihr getragen, auf Knien geschaukelt. Wie einen Mann, den seine Mutter tröstet, so tröste ich euch; in Jerusalem findet ihr Trost. Ihr werdet es sehen und euer Herz wird jubeln und eure Knochen werden sprossen wie frisches Grün. So offenbart sich die Hand des Herrn an seinen Knechten.
Je älter ich werde, umso mehr Erinnerungen gehen mir durch Kopf und Herz. Als ich die Lesung von heute in der Bibel aufschlug, um mich auf die Predigt vorzubereiten, kam mir Johannes Paul I. in den Sinn. Anlässlich der kürzlichen Papstwahl wurde in den Medien auch dieser Vorgänger Leos XIV. erwähnt. Sein Kennzeichen war das freundliche Lächeln, mit dem er sich den Menschen zuwandte.
Nur einen September lang im Drei-Päpste-Jahr 1978 verkörperte Johannes Paul I. jenen Geist, der das Angesicht der Erde erneuert: den göttlichen Geist der Menschenfreundlichkeit. Er spricht auch aus den Worten des Propheten Jesaja, die wir vorhin gehört haben: Worte voller Zärtlichkeit, Trostworte, Worte einer mütterlichen Zuneigung. Ich erinnere mich an einen Satz, mit dem dieser Papst – lange vor dem für seine Sponti-Sprüche bekannten Franziskus – nicht nur in kirchlichen Kreisen einige Verwirrung gestiftet und vor allem in den Medien ein großes Echo gefunden hat. Vor einer großen Menschenmenge sagte er, als sei es die größte Selbstverständlichkeit: „Gott ist nicht nur Vater, sondern auch und mehr noch Mutter!“
Johannes Paul I. wollte allen klarmachen, dass Gott kein Mann ist, dass vielmehr das Geheimnis allen Seins, das wir Gott nennen, männliche und weibliche Züge trägt. Und: Er wollte die Praxis dieser These! Er signalisierte einen neuen Stil. Die Zeichen standen auf Veränderung – auch und gerade für die sogenannte Amtskirche und das Amt in der Kirche. Dann über Nacht war er tot. Spürte der feinsinnige Mann, dass die Verwirklichung dieser Vision in der real existierenden römischen Kirche seine Kräfte überstieg?
Liebe Gemeinde, diese Aussage lag ganz auf der Linie, die sich wie ein roter Faden durch die heutige Lesung aus dem letzten Kapitel im Buch Jesaja zieht. Da ist die Rede von Jerusalem – der Hauptstadt Israels – als einer Mutter. Jerusalem war im wörtlichen Sinn die Metropole Israels. Dieser aus dem Griechischen stammende Begriff bedeutet ursprünglich Mutterstadt. Wie sonst könnte Jesaja über Jerusalem sagen: „Saugt euch satt an ihrer tröstenden Brust, trinkt und labt euch an ihrem mütterlichen Reichtum!“ So stand es in der Einheitsübersetzung der Bibel, die 1980 erschien.
Ein wunderbares Wort! Mütterlicher Reichtum: Dazu gehört tröstende Nähe, helfendes und heilendes Verstehen, Geborgenheit. Dazu gehört Liebe, die nährt und wachsen lässt. Dazu gehört auch die schönste aller Gaben, die Freigabe, denn eine Mutter sollte ihre Kinder nicht nur erziehen, sondern ziehen lassen.
Diesen mütterlichen Reichtum, den Reichtum Jerusalems wünsche ich uns in der Kirche. Weltweit und vor Ort. Auch unser Kloster, meine Brüder, lebt von der Quelle mütterlichen Reichtums. Im 72. Kapitel der Benediktsregel kommt das unüberhörbar zur Sprache: der „gute Eifer“, von dem da die Rede ist, bringt hervor: gegenseitige Geduld, zuvorkommendes Verhalten, achtsame Fürsorge.
Meine Schwestern und Brüder, mütterlicher Reichtum ist für jeden einfach lebensnotwendig – auch in der Gesellschaft! Gerade mütterlicher Reichtum könnte die Not der Gegenwart hierzulande wenden helfen. Die Not des inneren Menschen! Ohne die äußeren Nöte gering zu achten, meine ich in erster Linie die Ärmlichkeit der Herzen, die Verarmung der Seele infolge einer Vorherrschaft des männlichen Reichtums, der in der Sicht der Benediktsregel eher dem „bösen Eifer“ der Bitterkeit und des Ressentiments entstammt. Männlicher Reichtum – absolut gesetzt – geht auf Kosten der Seele des Menschen, die samt des Herzens im Klima bloßen Profitdenkens und schon in jungen Menschen angekurbelten Karrierestrebens krank werden muss. Es ist klar, dass dieser männliche Reichtum nicht nur eine Versuchung für Männer darstellt. Er ist eine Versuchung für alle. Über die positiven Seiten eines männlichen oder väterlichen Reichtums gäbe es allerdings auch viel zu sagen. Das aber ist heute nicht dran.
Mütterlicher Reichtum jedenfalls ist Reichtum an Liebe und das heißt letztlich Reichtum von Gott her, denn Gott ist Liebe. Hier gilt das Bibelwort: „Was hättest du, wenn du es nicht empfangen hättest?“ Wenn doch Gott den oft enttäuschten und mutlosen, den an den bestehenden Verhältnissen in Politik und Wirtschaft krankenden, den verunsicherten Menschen unserer Zeit, wenn uns allen Gott das sagen könnte: in der Kirche findet ihr meinen Trost. Nicht die schwächliche Vertröstung auf ein jenseitiges Irgendwann, nicht nur die trost-spenden-sollende Innerlichkeit, nicht nur eine bestens organisierte, aber blut- und blickleere, eine trostlose Nächstenliebe. Nein, in der Kirche findet ihr meinen Trost: ein konkretes, leidenschaftliches Engagement mit den Menschen, eine zärtliche Zuneigung ohne Berührungsangst, ein kraftvoll großzügiges Miteinanderteilen, eine verwundbare Liebe.
Allein das kann doch den Menschen wirklich trösten, das heißt – der Grundbedeutung von Trost entsprechend – ihm festen Stand und Wagemut geben. Allein das kann doch einem trauernden Menschen helfen, den bloßen Blick zurück wieder nach vorn zu wenden. Allein das kann einen gebrochenen Menschen aufrichten und stützen, den Schwachen stärken, ein enttäuschtes Herz wieder hoffen lassen.
Mit den Worten des Jesaja gesagt: „Wenn ihr das seht – meinen Trost, in Jerusalem, in der Kirche – wird euer Herz sich freuen!“ .