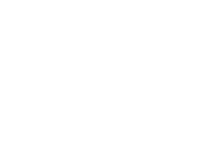von Br. Anno Schütte OSB
Beim heutigen Abschnitt aus dem Markusevangelium (Mk 6,7-13) ist es sinnvoll, den Textzusammenhang, das Davor und Danach, zu beachten: Davor steht die Erzählung von der Ablehnung Jesu in seiner Heimatstadt und durch seine Familie mit der Konsequenz, dass Jesus in die benachbarten Dörfer auszog, um dort zu lehren – wir hörten davon am letzten Sonntag. – Danach folgt der ausführliche Bericht von der Enthauptung des Täufers Johannes.
Unser heutiger Abschnitt, die Aussendung der Zwölf, ist von den Themen Ablehnung und Mord umgeben. Das ist schon ein Hinweis, wie das Leben Jesu weitergeht und wie es enden wird: Mit der Katastrophe eines Mordes am Kreuz. Doch Gott lässt sich von der Ignoranz und Bosheit der Menschen nicht aufhalten, das wird die Auferstehung Jesu und die österliche Aussendung der Jünger endgültig bestätigen. Die Aussendung der Zwölf schon jetzt, inmitten von Ablehnung und Mord, zielt in diese österliche Richtung: Gott geht weiter – und die Zwölf sollen ihre Aussendung in dieser Welt ein- und ausüben.
Die vorhergehende familiäre Ablehnung – gerade durch seine Nächsten – dürfte Jesus besonders getroffen haben. Doch lässt er sich davon nicht stoppen – im Gegenteil – es zieht ihn lehrend in die weite Nachbarschaft. Jesus lebt aus Gottesliebe selbstbestimmt, nicht fremd- oder familienbestimmt. Nun ruft er die Zwölf zu sich – es sieht so aus, dass auch sie seine Familie sind. Er löst biologische Familiengrenzen auf, weil alle Menschen existenziell zu seiner universalen Familie gehören sollen, denn alle stammen aus der Liebe des einen Gottes. Will er deshalb den Zwölfen vor der Aussendung nochmal besonders nahe sein? Gestärkt durch diese Intimität sendet er sie aus. Zu zweit sollen sie gehen, denn die Sache Jesu ist keine Solonummer – für Jesus ist das Ich immer in ein geschwisterliches Wir eingebunden – Selbst- und Nächstenliebe ist das Gebot.
Ausdrücklich gibt Jesus ihnen eine Vollmacht – das heißt: Sie sollen nicht im eigenen Sinne, sondern für ihn handeln. Sie sollen an seiner Stelle weiter tun, was sie nun schon eine Weile mit ihm unterwegs erfahren hatten: Aus und mit der Liebeskraft Gottes Menschen heilen und zu ihrer ureigenen Gotteskindschaft befreien. Denn die „unreinen Geister“ gehen der Menschheit nie aus: Sie zeigen sich in tötendem Ungeist kleiner und großer Ideologien, in jeder Form von Gewalt.
Nach der Vollmacht gibt Jesus ihnen zusätzlich ein detailliertes Gebot mit auf den Weg: Außer einem Wanderstab und Sandalen sollen sie nichts mitnehmen. Mit einer detaillierten Aufzählung verstärkt Jesus seine klare Entschiedenheit: „Kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld im Gürtel, kein zweites Hemd.“ Es ist eindeutig: Mit nichts meint Jesus auch nichts. Das ist schlicht und einfach radikal – eine echte Herausforderung – auch für uns, die wir mit allen möglichen Mitteln versuchen, der Sache Jesu zu dienen.
Da darf man fragen: Wie soll das gehen? Warum schickt er sie so unversorgt arm los? Von den Zwölfen erfahren wir nichts: keine Fragen, auch kein Protest oder Widerstand. Vielleicht gründet ihre Bereitschaft, so zu gehen, in den guten Erfahrungen, die sie bisher auf ihrem Weg mit Jesus gemacht hatten. Das Leben Jesu ist vor allem einfaches Da-Sein, gegenwärtig Sein – Leben aus der Liebes-Gegenwart Gottes, aus ihr wirken und sie bezeugen. Nur die beruhigt die existentielle Not, nicht genug zu sein; mit den Dingen dieser Welt können wir sie nicht stillen. Und konkret für den Lebensweg gilt: Ohne Gepäck geht es sich leichter. Jesus selbst ist arm unterwegs – wir erfahren nichts von irgendeiner Ausstattung. Auf seinem Weg vertraute er auf Gastfreundschaft und genoss sie – gerade erst war er im Haus des Synagogenvorstehers eingekehrt und hatte dessen Tochter geheilt. Aus dieser positiven Erfahrung gibt Jesus den Zwölfen die Empfehlung: „Bleibt in dem Haus, in dem ihr einkehrt, bis ihr den Ort wieder verlasst.“ Er lässt sie – buchstäblich – nicht im Regen stehen. Er vertraut auf die Güte und Gastfreundschaft der Menschen, denn auch darin verwirklicht sich seine frohe Botschaft: Der Mensch ist im Grunde gut und es tut ihm gut, gastfreundlich zu sein – mit Menschen zu teilen und Fremdheit in Vertrauen oder gar Freundschaft zu wandeln.
Doch Jesus ist Realist und weiß, dass es auch anders kommen kann: Die Türen der Häuser, mehr noch die Ohren und Herzen der Menschen, bleiben verschlossen. Was tun? Jesus empfiehlt: „… dann geht weiter …“. Er respektiert die Freiheit der Menschen, zu der auch das Nein-Sagen gehört, auch wenn sie sich damit Lebensmöglichkeiten vergeben. Wir hören kein Wort von „dranbleiben müssen“ oder „da muss man mal Druck machen“ – daraus spräche der Ungeist zwanghafter Gewalt und die Geschichte zeigt, dass es oft so gelaufen ist. Wie Jesus sollen die Zwölf ein Angebot machen und ein Angebot kann man annehmen oder ablehnen. Seine frohe Botschaft der Gottes- und Menschenliebe ist absolut gewaltfrei und deshalb kann sie auch nur so verkündet werden – Inhalt und Methode stimmen überein – anders wäre es unglaubwürdig.
Schlussendlich gibt Jesus ihnen noch ein beachtenswertes Detail mit auf den Weg: „… und schüttelt den Staub von euren Füßen, …“. Die Ablehnung, der Misserfolg ihrer Sendung, könnte sie frustrieren – Jesus kennt seine Zwölf. Menschen fixieren sich und andere in Erwartungen und die sind ein Konfliktprogramm. Darum der ausdrückliche Rat an die Zwölf, den drohenden Frust innerlich abzuschütteln wie den äußerlichen Staub von ihren Füßen. Auch unsere Sprache bestätigt das: Wer nach-tragend lebt, geht schwerer. Die Zwölf – und wir – sollen unbeschwert unterwegs sein, denn Jesu Botschaft ist leicht und will Leben erleichtern.
Mit diesen Empfehlungen gut ausgestattet, ziehen die Zwölf dann aus und verkündigen die Umkehr, wie es auch Johannes getan hatte. Der wird – wie erwähnt – direkt anschließend ermordet und das zeigt, wie böse Menschen sein können – da ist Umkehr bitternötig. Jesu Botschaft zielt auf konkretes Verhalten, auf konkrete Verhaltensänderung, wo es notwendig ist. Umkehr soll und kann die Not wenden und das will auch konkret eingefordert sein. Seine Botschaft ist nicht harmlos – an anderer Stelle sagt er: „Euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein.“ Es ist ein Ja zu lebendigem Lieben und ein Nein zur Gewalt – in all ihren Formen.
In dieser Spur setzen die Zwölf das Werk Jesu wirksam fort: Sie treiben viele Dämonen aus, salben viele Kranke und heilen sie. Das ist eine Vorschau auf die endgültige Sendung aller Jünger nach Jesu Tod und Auferstehung. Zu dieser Sendung sind auch wir eingeladen und berufen – darum heißt es am Ende dieser und jeder Messe: „Gehet hin! – In Frieden.“ Was kann uns besseres geschenkt sein, denn es geht um die spannendste Botschaft überhaupt.