Predigt am Benediktsfest (21.03.2025)
von Abt Cosmas Hoffmann OSB
Der Titel eines Films von Rainer Werner Fassbinder aus den 1970er-Jahren „Angst essen Seele auf“ beschreibt anschaulich und knapp die zersetzende und alles überlagernde Kraft eines Gefühls, das viele Menschen in den letzten Wochen und Monaten in seinem Bann hält.
Im Blick auf die politischen Entwicklungen drängten einen schon die ersten Krawalltage der neuen amerikanischen Präsidentschaft dazu, sich lieber auf das Schlimmste einzustellen und dann kam es von jenseits des Atlantiks immer schlimmer.
Populisten nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa, auch in unserem Land schüren die Ängste der Menschen vor Zuwanderung, Fremden, Wohlstandsverlust und Kriminalität – das ist ihre Spezialität, denn wer Angst hat, ist leicht zu manipulieren.
Wir fühlen uns in einem Mahlstrom schlechter Nachrichten, der uns aufzureiben scheint. Was bleibt, ist das Gefühl der Ohnmacht, das das Herz eng macht, die erschreckende Ahnung den Geschicken dieser krisengeschüttelten Welt vollkommen ausgeliefert zu sein: Was bitte kann ich da noch ausrichten oder gar verändern?
Doch wer seine Hoffnung verloren hat und eben nur noch mit dem Schlimmsten rechnet, erstarrt wie das Kaninchen vor der Schlange, vermag nicht mehr klar zu denken aus lauter Panik, ist unfähig nach Lösungen zu suchen und empfänglich für jene, die vermeintlich einfache Lösungen anbieten.
Doch statt einer Rhetorik der Angst bräuchte es jetzt eine der Verantwortung, eine der Verhältnismäßigkeit, bräuchte es die Kunst der Unterscheidung der Geister, um ruhig und sachlich zu erkennen und zu benennen, worum es geht und was zu tun ist.
Die Voraussetzung einer guten Unterscheidung der Geister ist die achtsame Wahrnehmung, zu der Benedikt gleich mit dem ersten Wort seiner Regel „Höre!“ aufruft. Genau diese Forderung der Regel hat der Prediger des Benediktsfestes im letzten Jahr, Erzbischof Udo Markus, klar und engagiert dargestellt. So passt es gut, am diesjährigen Benediktsfest den nächsten Schritt, die Unterscheidung der Geister, näher in den Blick zu nehmen.
Die Kunst der Unterscheidung der Geister findet sich bereits in der Hl. Schrift, sie wurde weiterentwickelt von den frühen Mönchen, den Wüstenvätern, deren Traditionen Johannes Cassian Anfang des 5. Jahrhunderts in seinen Schriften zusammenfasst. Benedikt folgt den Darlegungen Cassians und schätzt die discretio, so der lateinische Fachbegriff für die Unterscheidung der Geister, als Mutter aller Tugenden (RB 64,19), die dem einzelnen und der Gemeinschaft in der Suche nach dem Willen Gottes dient. Nach Gregor d.Gr. zeichne sich die Benediktsregel selbst vor allem durch ihre discretio aus.
Das Wort discretio ist die lateinische Übersetzung des griechischen Ursprungswortes diakrísis im Neuen Testament (u.a.1Kor 12,10; Hebr 5,14). In diesem griechischen Wort findet sich das eingedeutschte Wort „Krise“, das vom Verb „krínein“ (trennen, unterscheiden) abgeleitet ist. Das mit diesem Verb verbundene Tun wird oft mit einer Waage verglichen, die so lange unruhig hin- und herschaukelt, bis die Balance gefunden ist und die Waagschalen in eine Ruheposition gekommen sind.
In diesem Sinne eine Unterscheidung, d.h. Differenzierung, vorzunehmen, oder in einem weiteren Schritt eine Entscheidung zu treffen, bedeutet konkret, dass ich eine Situation, eine Angelegenheit, eine Frage wahrnehme und abwäge, bis mir klar ist, wie ich zu entscheiden, was ich zu tun habe.
Ich persönlich weiß sehr genau, wie es sich in mir anfühlt, wenn ich vom Kopf, vom Bauch und vom Herzen her erkenne, was richtig, was vom guten Geist ist, denn dann erlebe ich nach vielem Hin und Her der Gefühle und Gedanken, dass sich eine tiefe Ruhe und Gewissheit einstellt.
Die discretio ist Cassian zufolge die Unterscheidung zwischen dem guten und dem bösen Geist, zwischen dem, was mir auf dem Weg zu Gott nützt und was nicht. Konkret übt der Mönch die discretio, indem er wachsam auf die Gedanken und Bewegungen seines Herzens achtet; er beobachtet ihren Anfang und Verlauf und achtet auf die Motivation seines Tuns. Dabei weiß er, dass der böse Geist Unruhe, Verwirrung und Traurigkeit, der gute Geist Ruhe, Freude und Klarheit bringt.
Damit sind wir wieder bei der Ruhe, beim inneren Frieden, der als wahrnehmbares Merkmal des guten Geistes, der guten Unterscheidung gilt. Genau diese Ruhe zu finden, ist die verständliche Sehnsucht vieler Menschen in den aktuell wirren Zeiten.
Ein dritter Schritt ist dann das, was Benedikt nach dem Hören und Unterscheiden als nächstes fordert: „Erfülle es durch die Tat!“ (RB Prol 1).
Darum bedarf es neben der Rhetorik der Unterscheidung auch einer Rhetorik der Tatkraft, des ruhigen und starken Beispiels. Dahinter steht die Erfahrung, dass Ängste an Macht verlieren, wenn man sich selbstwirksam erlebt, etwas anpackt, gerade auch im Kleinen. Das kann konkret heißen, sich ehrenamtlich zu engagieren, Mut zum Widerspruch zu wagen, eine Geste der Solidarität und Unterstützung zu riskieren, politisch aktiv zu werden, sich in der Demokratie einzubringen. Denn die Demokratie lebt davon, dass die Bürgerinnen und Bürger sich daran beteiligen und nicht davon, dass von oben herab Dekrete erlassen werden, die mit dickem Filzstift kamerakonform unterschrieben werden.
Bei seiner ersten Vereidigung in das Amt des amerikanischen Präsidenten sagte Franklin Delano Roosevelt am 4. März 1933: „Also zunächst einmal lassen Sie mich meiner Überzeugung Ausdruck verleihen, dass es nur eine Sache gibt, die wir fürchten müssen, die Furcht selbst“.
Mittlerweile scheinen die europäischen Regierungen wieder ihre Fassung gewonnen zu haben und damit auch die Tatkraft, sich den aktuellen Herausforderungen gemeinsam zu stellen.
Hoffen wir, dass in unserem Land zeitnah eine neue Regierung gebildet werden kann – erste Schritte wurden ja schon unternommen.
Doch letztlich liegt es an uns allen, dass wir uns als Bürgerinnen und Bürger und vor allem auch als Getaufte engagieren, Unterscheidung und Tatkraft verbinden.
Dafür ist gerade diese Zeit auf dem Weg zum Osterfest eine gute Gelegenheit, denn in der Osterfeier strahlt uns die Hoffnung auf, dass wir, wie Benedikt am Ende seiner Regel schreibt, gemeinsam mit Christus, dem Auferstandenen, zum ewigen Leben gelangen (RB 72, 12).
Folgen wir den Empfehlungen von Bischof Georg Bätzing, der letzte Woche als Vorsitzender während der Deutschen Bischofskonferenz auf der Frühjahrsvollversammlung dafür geworben hat in diesen Tagen: „in kleinen Schritten das tägliche Verhalten zu verändern: Mitgefühl, Barmherzigkeit, die Achtung der Würde und der unveräußerlichen Rechte jeder Person, ein weniger individualistisches und mehr gemeinschaftliches Verständnis von gutem Leben, Frieden und Sicherheit und die Entwicklung von Gemeinschaft über Unterschiede hinweg, Gottesdienst durch Nächstendienst, ein durch die Liebe wirkender Glaube.“
Wenn wir dies wagen, kann wahr werden, was uns in der Lesung aus dem Philipperbrief (4,4-9) verheißen wurde:
„Freut euch im Herrn zu jeder Zeit! Noch einmal sage ich: Freut euch! Der Herr ist nahe. Der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein.“

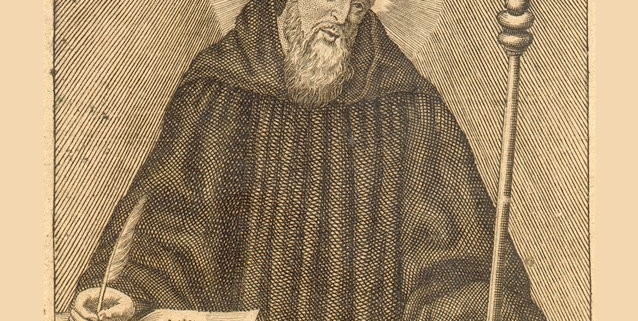


 Christina Kulot
Christina Kulot